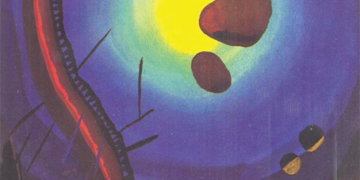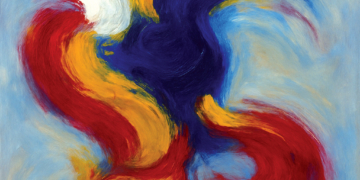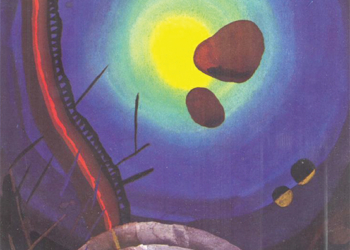Lassen Sie mich mit einem Zitat aus einem Werk beginnen, von dem sich die meisten von uns wünschen, dass Kant es nie geschrieben hätte, und das er in der Tat nicht geschrieben hat: Die Anthropologie basiert auf den Vorlesungsmitschriften seiner Studenten. Aber zwischen einigen peinlichen und sogar abscheulichen Bemerkungen sind gelegentlich Perlen wie diese versteckt:
Es ist eine eigentümliche Angewohnheit unserer Aufmerksamkeitsfähigkeit, sich genau auf das zu konzentrieren, was an einem anderen Menschen mangelhaft ist, und zwar ungewollt: sich auf den fehlenden Knopf am Mantel des Anderen zu konzentrieren oder auf die Zahnlücke oder auf einen erworbenen Sprachfehler und damit nicht nur den Anderen zu konsternieren, sondern auch uns selbst zu entwürdigen.”
Es ist eine eigentümliche Angewohnheit unserer Aufmerksamkeitsfähigkeit, sich genau auf das zu konzentrieren, was an einem anderen Menschen mangelhaft ist, und zwar ungewollt […] und damit nicht nur den Anderen zu konsternieren, sondern auch uns selbst zu entwürdigen.
Besonders gut gefällt mir die Bemerkung, dass wir uns selbst entwürdigen, wenn wir uns auf Fehler konzentrieren. Goethe schrieb, dass die Lektüre von Kants Werk – zumindest für einige von uns – nicht nur wie das Betreten eines gut beleuchteten Raumes ist. Einige seiner Seitenhiebe, vor allem auf menschliche Schwächen, werfen Lichtstrahlen auf einfache, aber tiefe Züge, die wir irgendwie nicht bemerken; Freud hat uns nichts Besseres gegeben. Sich ausschließlich auf die Schwächen eines Menschen zu konzentrieren, entwürdigt uns; ich habe ein leichtes Gefühl der Hässlichkeit bemerkt, nachdem ich eine Stunde damit verbracht habe, die Schwächen eines Kollegen zu sezieren. Natürlich gibt es Kollegen, deren Verhalten Kritik verdient, und es gibt hässliche Arten, dies zu tun, und solche, die respektvoll und vielleicht sogar konstruktiv sind. Aber ich fühle mich immer besser und gehe zufriedener nach Hause, wenn ich eine Stunde lang über Kollegen gesprochen habe, die ich bewundere.
Kants Bemerkung über die Fokussierung auf Fehler passt zu der Flut von Schriften über Kants angeblichen Rassismus und Kolonialismus, die vor etwa 30 Jahren begann und heute das heißeste Thema in der Kant-Forschung ist, sowohl unter Fachleuten als auch in der breiten Öffentlichkeit. Es ist nicht nur unsere verstärkte Aufmerksamkeit für Rassismus und Kolonialismus, die sie zu einem Schwerpunkt der Kant-Diskussion gemacht hat; ich finde es generell gut, dass wir uns der Geschichte des Kolonialismus und der systemischen Auswirkungen des Rassismus stärker bewusst geworden sind. Dennoch hat es etwas mit der ständigen Konzentration auf die Frage zu tun, wie rassistisch er war. Das hat etwas Hyänenhaftes, ein entwürdigendes Vergnügen daran, die Fehler in Kants Werk wiederzukäuen. Aber dieser Fokus wird so lange bestehen bleiben, bis wir uns systematischer damit auseinandersetzen. Was ich hier also anbieten möchte, ist eine Skizze der philosophischen und nicht der textlichen Fragen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir Kant in das 21. Jahrhundert tragen wollen.
Sich ausschließlich auf die Schwächen eines Menschen zu konzentrieren, entwürdigt uns; ich habe ein leichtes Gefühl der Hässlichkeit bemerkt, nachdem ich eine Stunde damit verbracht habe, die Schwächen eines Kollegen zu sezieren.
Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, mit der Fülle von unbestreitbar rassistischen Äußerungen umzugehen, die Kants Werk durchziehen:
(1) Wir können diese Passagen ignorieren, so wie wir eine Zahnlücke oder einen fehlenden Knopf am Mantel eines Menschen ignorieren würden, aus Höflichkeit und dem Wunsch heraus, uns nicht selbst zu erniedrigen, indem wir uns auf kleine Fehler konzentrieren. Quine erhob diese Haltung zum sogenannten Prinzip der Nächstenliebe, das, wie viele Akte der Nächstenliebe, seinen Empfängern nicht immer gerecht wurde. Aber diese Passagen als unglückliche, aber triviale Fliegen in der Suppe zu ignorieren, war sicherlich das, das bis zum Ende des 20. Jahrhunderts getan wurde, als insbesondere Charles Mills Fragen des Rassismus in den Vordergrund der philosophischen Diskussionen über den Liberalismus und die Gesellschaftsvertragstheorie rückte. Ich denke, dass Mills im Unrecht war, wie ich später noch erläutern werde, aber ich denke auch, dass das Prinzip der Nächstenliebe Lücken hinterlässt, sodass es besser und auf jeden Fall unvermeidlich ist, Fragen des Kant’schen Rassismus nicht weiter unter den Teppich zu kehren.
(2) Die zweite Möglichkeit ist die vorherrschende – vielleicht, weil sie die einfachste ist und ein einfacher Pendelschlag. Sie besagt, dass Kants Rassismus nicht zufällig, sondern systemisch ist und sein gesamtes Werk durchdringt. Diese Ansicht teilen auch Mills, Bernasconi, Lu-Adler und andere, die zu zeigen versucht haben, wie tief der Rassismus in der kritischen Philosophie verankert ist. Leider ist dies die Ansicht, die zunehmend zum Standard wird, und zwar nicht unter Kant-Forschern, sondern beispielsweise im englischen Wikipedia-Artikel über Kant. Darin wird einfach und unverblümt festgestellt, dass er ein Rassist war, und zwar sowohl im einleitenden Absatz als auch in einem separaten Abschnitt, der dem Rassismus gewidmet ist, der nach Ansicht der Wikipedia-Autoren seinen Kosmopolitismus in Frage stellt. Die Kant-Forscherin Cheryce von Xylander hat wiederholt versucht, Wikipedia dazu zu bringen, diese Behauptung zumindest zu problematisieren, musste aber feststellen, dass die Behauptungen auf mysteriöse Weise jedes Mal wieder eingestellt und ihre Kommentare gelöscht wurden.
Kants Bemerkung über die Fokussierung auf Fehler trifft auf die Debatten über seinen angeblichen Rassismus zu – ein zentrales Thema der Kant-Forschung. Zwar ist das gesteigerte Bewusstsein für Kolonialismus begrüßenswert, doch die fixierte Suche nach seinen Fehlern wirkt oft hyänenhaft. Stattdessen braucht es eine systematische Auseinandersetzung, um Kant ins 21. Jahrhundert zu übertragen.
(3) Eine dritte Möglichkeit, die vor allem von Pauline Kleingeld angeboten wird, bietet einen Ausweg aus diesen binären Entscheidungen, und ich bin ihrer Arbeit zu Dank verpflichtet. Sie hat eine entscheidende Entwicklungslinie in Kants Werk nachgezeichnet, die von der Wiederholung rassistischer Vorurteile, die so sehr im Widerspruch zu seiner systematischen Philosophie stehen, zu dem entschiedenen Kosmopolitismus und der Ablehnung des Kolonialismus führt, die wir in seinem letzten Jahrzehnt finden. Pauline lehnt es ab, über Kants innere Zustände zu spekulieren, oder darüber, welche Gedanken ihn dazu veranlasst haben könnten, seine Kommentare mit seinen systematischen Ansichten in Einklang zu bringen, und natürlich hat sie Recht, angesichts des Mangels an Beweisen vorsichtig zu sein. Ich möchte nur hinzufügen, dass, welche subjektiven Prozesse auch immer Kants Entwicklung begleiteten, es sich objektiv um einen Fortschritt sowohl der theoretischen als auch der praktischen Vernunft handelte – etwas, das die Kantianer unter uns sicherlich bejubeln sollten. Warum nehmen wir nicht an, dass er zu der Einsicht kam, dass seine Äußerungen über außereuropäische Völker sowohl mit seinen moralischen als auch mit seinen metaphysischen Ansichten völlig unvereinbar waren? Wir könnten dann die Tatsache, dass er dies tat, als ein Beispiel für einen moralischen Fortschritt bejubeln, der überzeugender ist als der, den er im Streit der Fakultäten anführt, die Hoffnung, die unbeteiligte Beobachter beim Betrachten der französischen Revolution empfinden. Die Tatsache, dass selbst der größte Denker Zeit brauchte, um seine Ansichten zu verfeinern und weiterzuentwickeln und sie in eine annähernd kohärente Form zu bringen, sollte uns Hoffnung geben, dass der Rest von uns dasselbe tun kann – anstatt sich im Sumpf der Enttäuschung zu wälzen, dass er es nicht auf Anhieb richtiggemacht hat. Kants Glaube an die Macht der Vernunft ist immer mit einem Bewusstsein für ihre Grenzen verbunden. Wer weiß? Wären ihm noch ein oder zwei Jahrzehnte vergönnt gewesen, hätte er vielleicht sogar seine schändlichen Äußerungen über Juden und Frauen zurückgenommen. – Als Jüdin muss ich sagen, dass ich nie dachte, seine Bemerkungen über meinen Stamm oder meine Stämme seien mehr Aufmerksamkeit wert als ein fehlender Knopf an einem Mantel. Die Mängel verblassen angesichts des Glanzes seiner kritischen Theorie.
Eine Reihe von Kant-Forschern hat uns also genügend Anhaltspunkte gegeben, wenn wir die derzeitige Tendenz zurückweisen wollen, Kants rassistische Äußerungen zu benutzen, um das ganze System zu Fall zu bringen. Und ich denke, dass Details wichtig sind, wie beispielsweise die Tatsache, dass Kant die berüchtigte Diskussion über Rassenhierarchien nicht in die endgültig veröffentlichte Fassung der Anthropologie aufgenommen hat. Aber ich möchte mich von diesen Fragen zurückziehen, denn ich mache mir weniger Sorgen um Philosophen und schon gar nicht um Kant-Gelehrte, als vielmehr um eine kulturelle Praxis, die in weiten Teilen, wenn auch nicht auf dem ganzen Globus, verbreitet ist. Grob gesagt ist es ein Kampf zwischen der Aufklärung und dem Postkolonialismus, und die Aufklärung ist dabei zu verlieren. Ich weiß, dass dies eine Kant-Konferenz ist, also sollten wir die Dinge nicht grob ausdrücken, aber es sind die groben Versionen, die in der Kultur verbleiben, und ich rede jetzt nicht von Wikipedia. Da ich seit einem Vierteljahrhundert als Philosophin außerhalb einer philosophischen Fakultät arbeite, habe ich darauf geachtet, wie Kollegen in anderen Abteilungen mit philosophischen Fragen umgehen, die sich ihnen stellen. Ich denke an den Vortrag eines angesehenen deutschen Soziologen, der sich auf „die Dialektik der Aufklärung, Sie wissen schon, was Adorno und Horkheimer als die dunkle Seite sahen, Kolonialismus und so weiter“ bezog. Auf die Frage nach einer Passage, in der die Dialektik der Aufklärung den Kolonialismus erwähnt, konnte er natürlich keine nennen, aber es gibt heute kein sanfteres Ziel als die Aufklärung, auch wenn ein Großteil des Aufklärungs-Bashings alle möglichen Vorwürfe in einer Schlammsuppe wälzt und hofft, dass einer davon hängen bleibt. Vor einem Jahrhundert war die Moderne die Quelle all unserer Übel; der Aufklärung die Schuld zu geben, klingt genauer, ist es aber nicht. Ich denke auch an eine E-Mail, die ich diese Woche von einer noch angeseheneren amerikanischen Historikerin erhalten habe, die mir für einen Aufsatz dankte, den ich für die NYT geschrieben hatte und der „fast“ ihre Meinung zu Kant änderte, den sie wegen seiner Äußerungen über Nichteuropäer verworfen hatte.
Das Merkwürdigste an der Ablehnung der Aufklärung als eurozentrisch ist die Tatsache, dass es die Aufklärung selbst war, die den Vorwurf des Eurozentrismus erfunden hat. Wenn zeitgenössische postkoloniale Theoretiker zu Recht darauf bestehen, dass wir lernen sollten, die Welt aus der Perspektive von Nichteuropäern zu betrachten, dann knüpfen sie an eine Tradition an, die auf Montesquieu zurückgeht, der fiktive Perser benutzte, um die europäischen Sitten in einer Weise zu kritisieren, die er als Franzose, der in seiner eigenen Sprache schrieb, nicht hätte tun können. Auf Montesquieus Die persischen Briefe folgten zahlreiche weitere Schriften, die sich desselben Mittels bedienten. Lahontans Dialog mit einem Huronen und Diderots Beilage zu Bougainvilles Reise kritisierten die patriarchalischen Sexualgesetze Europas aus der Perspektive der egalitären Huronen und Tahitianer, die Frauen, die uneheliche Kinder zur Welt brachten, unter Strafe stellten. Voltaires schärfste Angriffe auf das Christentum wurden aus der Sicht eines chinesischen Kaisers und eines indigenen südamerikanischen Priesters geschrieben.
Der Anthropologe David Graeber und der Archäologe David Wengrow führen in ihrem jüngsten Bestseller The Dawn of Everything ein interessantes Argument an: Die Kritik der Aufklärung an Europa aus der Perspektive außereuropäischer Beobachter wurde in der Regel als literarische Strategie verstanden. Die Autoren legten ihre eigenen Gedanken in den Mund imaginärer Nichteuropäer, um der Verfolgung zu entgehen, der sie sonst ausgesetzt gewesen wären, wenn sie sie ausgesprochen hätten. Graeber und Wengrow bestehen darauf, dass die nicht-europäischen Gesprächspartner real waren. Ihre Argumente stützen sich größtenteils auf eine Studie von Lahontans Dialog mit einem Huronen, der 1703 zu Beginn der Aufklärung veröffentlicht wurde und ein enorm erfolgreiches Buch war, das viele Nachahmungen inspirierte. Das Buch des französischen Schriftstellers schildert eine Reihe von Gesprächen mit einem wendatischen Denker und Staatsmann namens Kandiaronk, die Lahontan im Laufe der Jahre in Kanada führte, wo er die Sprachen Algonquin und Wendat fließend beherrschte. Anstatt wie viele andere davon auszugehen, dass die Ureinwohner nicht in der Lage waren, so raffiniert politisch zu argumentieren, wie es Kandiaronk zugeschrieben wird, legen Graeber und Wengrow einige Beweise dafür vor, dass der historische Kandiaronk für seine Brillanz und Eloquenz bekannt war und sich an genau der Art von Debatten mit Europäern beteiligte, die Lahontan aufgezeichnet hat.
Die frühen Kolonialstudien […] hatten einen ganz anderen Schwerpunkt als die postkoloniale Theorie heute. Ihr Schwerpunkt lag gerade nicht auf der Kolonialzeit und ihren Schrecken, sondern auf der afrikanischen und indischen Geschichte vor dem Kolonialismus.
Ihre Beweise sind nicht schlüssig, und einige ihrer Behauptungen über die Aufklärung sind falsch. Der historische Kandiaronk war nur ein Beispiel für viele Stimmen, die die Ohren der Aufklärer erreichten. Die Kritik der Ureinwohner an Geld, Eigentumsrechten und sozialen Hierarchien hatte seit dem sechzehnten Jahrhundert die Aufmerksamkeit der Europäer auf sich gezogen. Sie beeinflussten auch sicherlich die Kritik der Aufklärung, wie Denker der Aufklärung bezeugten. Wir werden wohl nie erfahren, wie viele dieser Kritiken ausgedacht waren und wie viele nicht. Wie die meisten literarischen Bestrebungen waren sie wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Während sie aufzeigen, was europäische und außereuropäische Verteidiger der Aufklärung gemeinsam hatten, implizieren Graeber und Wengrow, dass die Aufklärung gerettet werden muss, indem sie ihr einen außereuropäischen Ursprung zuschreiben, und legen nahe, dass die Europäer einheimische Ideen zusammen mit dem Territorium gestohlen haben; sie schreiben offen über die Dekolonisierung der Aufklärung. – Was die Debatten über The Dawn of Everything jedoch zweifelsohne unterstreichen, ist, dass die Aufklärung wegweisend war, indem sie den Eurozentrismus ablehnte und die Europäer aufforderte, sich selbst aus der Perspektive der übrigen Welt zu betrachten.
Die Auseinandersetzung der Aufklärung mit der außereuropäischen Welt war selten uneigennützig. Ihre Denker studierten den Islam, um eine universelle Religion zu finden, die die Fehler des Christentums hervorheben konnte. Bayle und Voltaire argumentierten, der Islam sei weniger grausam und blutig als das Christentum, weil er toleranter und rationaler sei. Bei der Sinophilie, die die frühe Aufklärung erfasste, ging es nicht um Porzellan oder um die bloße Neugier auf eine ferne antike Kultur; das Studium der Chinesen war Teil einer Agenda. Bürgerliche Franzosen, die sich über die feudalen Beschränkungen ärgerten, durch die staatliche Aufträge an Aristokraten vergeben wurden, lobten das konfuzianische System, in dem der Aufstieg auf so viel Verdienst beruhte, wie durch nationale Prüfungen gemessen werden konnte. Die Praxis, kulturübergreifende anthropologische Erkenntnisse zur Untermauerung der eigenen Argumente heranzuziehen, war so weit verbreitet, dass sie vom Marquis de Sade verwendet oder parodiert wurde: Meistens ging es bei der Untersuchung außereuropäischer Kulturen darum, die Mängel der europäischen herauszustellen. In Sades Werk sollen Aufzählungen außereuropäischer Verbrechen, die oft von fadenscheinigen Fußnoten begleitet werden, das Gegenteil beweisen: Überall findet man Grausamkeit ohne Ende.
Das Neue im 18. Jahrhundert war nicht der Kolonialismus, sondern die Opposition gegen ihn.
Die aufklärerischen Porträts von Nichteuropäern werden uns noch in den Ohren klingen. Angesichts der begrenzten Reisemöglichkeiten mussten sich die Denker des 18. Jahrhunderts auf eine kleine Anzahl von Berichten stützen, die oft Karikaturen wiederholten, die später kolonialen Interessen dienten. Aber wir sollten anerkennen, wie weit sie durch schiere Gedankenkraft kamen, ohne die Möglichkeit, außereuropäische Erfahrungen in ihre Ansichten einfließen zu lassen. Selbst Goethe kam schließlich nur bis nach Sizilien. Im Gegensatz zu den heutigen Kritikern waren sich die Denker der Aufklärung der Lücken in ihrem eigenen Wissen sehr wohl bewusst. Hier ist Rousseau, der 1754 schrieb:
„Obwohl die Bewohner Europas in den letzten drei- oder vierhundert Jahren die anderen Teile der Welt überrannt haben und ständig neue Sammlungen von Reisen und Berichten veröffentlichen, bin ich überzeugt, dass die einzigen Menschen, die wir kennen, Europäer sind. (…) wir kennen die Völker Ostindiens nicht, die ausschließlich von Europäern besucht werden, die mehr daran interessiert sind, ihren Geldbeutel als ihren Kopf zu füllen. Ganz Afrika und seine zahlreichen Bewohner, die ebenso bemerkenswert in ihrem Charakter wie in ihrer Farbe sind, müssen noch erforscht werden; die ganze Erde ist mit Völkern bedeckt, von denen wir nur die Namen kennen, und doch geben wir vor, die Menschheit zu beurteilen!“
Rousseau war da keine Ausnahme. Diderot warnte davor, sich ein Urteil über China zu bilden, ohne gründliche Kenntnisse der Sprache und Literatur des Landes zu besitzen und die Gelegenheit zu haben, “alle Provinzen zu bereisen und sich mit Chinesen aller Stände frei zu unterhalten.” Kant wies auf die Schwierigkeit hin, Schlussfolgerungen aus einander widersprechenden ethnographischen Berichten zu ziehen, von denen einige für die intellektuelle Überlegenheit der Europäer plädieren und andere, deren Beweise für die gleichen natürlichen Fähigkeiten von Afrikanern und amerikanischen Ureinwohnern ebenso plausibel sind. Die besten Denker der Aufklärung waren sich der Grenzen ihres Wissens bewusst und mahnten zur Vorsicht und Skepsis beim Lesen empirischer Beschreibungen außereuropäischer Völker. Dennoch kritisierten sie scharf die eigennützigen Vorurteile, die politisch motivierte Darstellungen nährten. Hier ist Diderot über die spanische Eroberung von Mexiko: „Sie meinten, diese Menschen hätten keine Regierungsform, weil sie nicht in einer Hand lägen, keine Zivilisation, weil sie sich von der Madrider unterscheide, keine Tugenden, weil sie nicht dieselbe religiöse Überzeugung hätten, und keinen Verstand, weil sie nicht dieselben Ansichten hätten.“
Die Denker der Aufklärung waren weder gegen die Natur noch gegen die Leidenschaft […] Aber sie wussten, wie oft Unterdrückung durch Behauptungen über eine angebliche natürliche Ordnung gerechtfertigt wird.
Diese Worte wurden, wie viele andere, anonym veröffentlicht, eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, um zu vermeiden, dass Diderot wegen früherer Schriften erneut ins Gefängnis muss. Nicht jeder Autor der Aufklärung hatte so viel Glück, denn die Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, beschränkten sich nicht auf Ausbrüche auf Twitter. Christian Wolff wurde 1723 mit einer Frist von achtundvierzig Stunden aufgefordert, seine Professur in Halle und den Staat Preußen zu verlassen oder mit der Hinrichtung zu rechnen – vor allem, weil er öffentlich argumentierte, dass die Chinesen auch ohne das Christentum vollkommen moralisch seien. Seine Erfahrung war keine Ausnahme: Fast alle kanonischen Texte der Aufklärung wurden verboten, verbrannt oder anonym veröffentlicht. So unterschiedlich sie auch waren, alle wurden als Bedrohung der etablierten Autorität im Namen universeller Prinzipien angesehen, die für jeden in jeder Kultur gelten.
Ich gehe davon aus, dass diese und andere Beispiele vielen Teilnehmern dieser Konferenz bekannt sind, aber wir müssen sie mit mehr Nachdruck ansprechen. Ich denke, viele von uns lassen sich von postkolonialen Theoretikern einschüchtern, weil wir Angst haben, als Imperialisten bezeichnet zu werden, wenn wir anderer Meinung sind – und es gibt schlechte Schauspieler, die diesen Vorwurf gerne erheben. Außerdem ist die Prosa oft so undurchdringlich, dass wir uns nicht die Mühe gemacht haben, sie zu verstehen, und würden wir unsere Zeit nicht lieber in den gut beleuchteten Räumen der Aufklärungsphilosophie verbringen? Zumindest dachte ich das eine Zeit lang, bis mir klar wurde, wie viel einflussreicher die postkoloniale Theorie heute ist als das Denken der Aufklärung, und ich beschloss, dass es wichtig ist, sich mit ersterer zu beschäftigen. Ich bin keineswegs tief in ihr verwurzelt, aber ich habe in den letzten Jahren einiges darüber gelernt.
Das Wichtigste, das ich gelernt habe, ist, dass es fatal ist, den Antikolonialismus mit der postkolonialen Theorie zu verwechseln, auch wenn das ein Taschenspielertrick ist, den viele postkoloniale Theoretiker machen. Die frühen Kolonialstudien – die laut dem Kolonialhistoriker Frederick Cooper 1951 begannen – hatten einen ganz anderen Schwerpunkt als die postkoloniale Theorie heute. Ihr Schwerpunkt lag gerade nicht auf der Kolonialzeit und ihren Schrecken, sondern auf der afrikanischen und indischen Geschichte vor dem Kolonialismus, um die Behauptungen von Hegel und anderen zu widerlegen, dass insbesondere Afrika keine Geschichte hatte, bevor die Europäer kamen. (In seinem ausgezeichneten Buch Against Decolonisation weist der nigerianische Philosoph Olufemi Taiwo darauf hin, dass Nordafrika 700 Jahre lang Spanien kolonisiert hat, also viel länger als die etwa hundert Jahre, die die Europäer Afrika kolonisierten. Dennoch behandeln die Spanier diesen Zeitraum als eine Episode ihrer Geschichte, nicht als die entscheidende. Taiwo fordert die Afrikaner auf, dasselbe zu tun). Zweitens konzentrierten sich die frühen Kolonialwissenschaftler auf die Untersuchung des Widerstands gegen den Kolonialismus, nicht auf das Leiden unter ihm.
Die Abstraktion zur Menschlichkeit erfordert den Einsatz der Vernunft, um über die Erscheinungen hinauszugehen, die uns Körper in verschiedenen Farben und Konfigurationen geben.
Rassismus und Kolonialismus müssen nicht zusammengehören, aber es ist einfacher für den Kolonialismus, wenn sie zusammengehören, denn der Rassismus scheint eine Art Rechtfertigung für den Kolonialismus zu sein. Ich werde beides zusammen behandeln. Aber man kann kolonialistisch sein, sogar völkermörderisch kolonialistisch, ohne überhaupt rassistisch zu sein, wie wir spätestens seit Thukydides wissen sollten: Die Athener hielten die Melier nicht für rassisch minderwertig, nur kleiner und schwächer. Das genügte: Große Staaten schlucken kleine, wie die Nacht den Tag; das ist ein Naturgesetz, gegen das die Vernunft keinen Anspruch hat. Als Frantz Fanon 1961 schrieb, dass mit der Entkolonialisierung ein neues Kapitel der Geschichte beginnt, hat er nicht übertrieben. Stärkere Nationen haben die schwächeren seit Beginn der aufgezeichneten Geschichte überholt, und zwar schon, bevor es überhaupt Nationen in unserem Sinne gab. Bis ins letzte Jahrhundert war der Imperialismus eine ebenso universelle politische Praxis wie jede andere: Die Römer und die Chinesen gründeten Imperien, ebenso wie die Assyrer, die Azteken, die Malier, die Khmer, die Moguln und die Osmanen – um nur einige zu nennen. Diese Imperien operierten mit unterschiedlichen Graden von Brutalität und Unterdrückung, aber alle basierten auf einer Gleichung von Macht und Recht, die auf überhaupt kein Konzept von Recht hinausläuft. Sie alle nutzten ihre Macht, um schwächere Gruppen zu zwingen, Ressourcen abzutreten, Tribut zu zahlen, Soldaten für weitere imperiale Kriege zu verpflichten und Befehle zu akzeptieren, die sich über lokale Bräuche und Gesetze hinwegsetzten. Soweit wir wissen, fehlte ihnen nur eines: ein schlechtes Gewissen.
Das Neue im 18. Jahrhundert war nicht der Kolonialismus, sondern die Opposition gegen ihn. Im 16. Jahrhundert protestierte Bartolomeo de las Casas gegen die Grausamkeit der spanischen Behandlung der amerikanischen Ureinwohner, aber nicht gegen die Institutionen der Sklaverei oder des Kolonialismus selbst. Zumindest anfangs vertrat er die Ansicht, dass versklavte Afrikaner importiert werden sollten, um die Arbeit zu verrichten, mit der die Konquistadoren die indigenen Völker Amerikas quälten. Die Idee, dass moralische Gesetze und universelle Rechte Machtansprüche einschränken sollten, fehlt auf der athenischen Seite des Dialogs, auch wenn die Melianer versuchen, sie zu verteidigen, so Las Casas. Die Geschichte berichtet, was mit ihnen geschah: Nach einer langen Belagerung und Schlacht wurden die Männer vernichtet, die Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Nichts davon war rassistisch motiviert, aber es ist ein Muster, das seit Jahrtausenden als natürlich angesehen wurde.
Die aufklärerischen Porträts von Nichteuropäern werden uns noch in den Ohren klingen. Angesichts der begrenzten Reisemöglichkeiten mussten sich die Denker des 18. Jahrhunderts auf eine kleine Anzahl von Berichten stützen, die oft Karikaturen wiederholten, die später kolonialen Interessen dienten. Aber wir sollten anerkennen, wie weit sie durch schiere Gedankenkraft kamen, ohne die Möglichkeit, außereuropäische Erfahrungen in ihre Ansichten einfließen zu lassen.
Es ist genug, um die Verteidiger der Aufklärung zum Weinen zu bringen. Wie oft haben Sie schon Sätze gehört oder gesehen, die bestenfalls “die Ambivalenz der Aufklärung” verkünden? “Die Aufklärung war das Zeitalter der Vernunft und der Menschenrechte, aber sie war auch das Zeitalter der Sklaverei und des Kolonialismus.” (Dieser Satz stand wie ein Mantra an der Kant-Ausstellung in Bonn.) Das verwechselt nicht nur Kausalität und Korrelation, sondern stellt die Geschichte, auch die Ideengeschichte, auf den Kopf. Was die Aufklärer begannen, war nicht die Verteidigung des Kolonialismus, sondern der Widerstand gegen ihn, und zwar nicht nur mit allgemeinen Behauptungen über Würde und Menschenrechte, sondern mit ganz konkreten Beispielen. Sie argumentierten sogar, dass außereuropäische Völker das Recht hätten, sich der Kolonisierung zu widersetzen.
Die meisten von Ihnen werden die Passage des Ewigen Friedens kennen, in der Kant argumentiert, dass der Kolonialismus jede Art von Übel verursacht, die die Menschheit betrifft. Und obwohl er die Weisheit Chinas und Japans lobt, die sich den europäischen Eindringlingen verschlossen haben, beschränkt sich seine Kritik am Kolonialismus nicht auf die Eroberung alter, hochentwickelter Kulturen. Zu einer Zeit, als die aufstrebenden Kolonialmächte ihre Eroberung indigener Gebiete in Afrika und Amerika damit rechtfertigten, dass diese Länder unbesetzt und ihre Völker unzivilisiert seien, prangerte Kant die Ungerechtigkeit an, die “die Bewohner als nichts zählte”.
Diderot ging sogar noch weiter und vertrat die Ansicht, dass die von den europäischen Kolonisatoren bedrohten Eingeborenen die Vernunft, das Recht und die Menschlichkeit auf ihrer Seite hätten, wenn sie die Eindringlinge einfach wie die wilden Tiere töteten, denen sie ähnelten. Die Hottentotten, so drängte er, sollten sich nicht von den falschen Versprechungen der Niederländischen Ostindischen Kompanie täuschen lassen, die kürzlich Kapstadt gegründet hatte.
“Fliegt, Hottentotten, fliegt! Nehmt eure Äxte, spannt eure Bögen und schickt einen Regen von vergifteten Pfeilen gegen diese Fremden. Möge nicht einer von ihnen übrig bleiben, um seinem Land die Nachricht von ihrem Unglück zu überbringen.”
Wenn man die Waffen aktualisiert, könnte man meinen, man sei auf ein Zitat von Frantz Fanon gestoßen. Auch diese Passage ist nicht ungewöhnlich: Der Philosoph aus dem 18. Jahrhundert rief mindestens ebenso oft und oft noch drastischer zu antikolonialistischer Gewalt auf als der Psychiater aus dem zwanzigsten Jahrhundert.
Wie Rousseau erkannte auch Diderot und Kant die Grenzen europäischen Wissens über fremde Kulturen. Diderot forderte gründliche China-Studien, Kant warnte vor voreiligen Rückschlüssen aus widersprüchlichen Reiseberichten. Trotz begrenzter Quellen kritisierten sie scharf die eurozentrische Arroganz – etwa Diderots Verurteilung der spanischen Eroberer, die mexikanische Kultur pauschal abwerten.
Die Kritiker der Aufklärung haben nicht nur auf die Grausamkeit des Imperiums hingewiesen. Sie dekonstruierten auch die Theorien, mit denen der Raub von Land und Ressourcen der Ureinwohner gerechtfertigt werden sollte. Die wichtigste dieser Theorien war John Lockes Arbeitswerttheorie, mit der argumentiert wurde, dass nomadische Völker keinen Anspruch auf das Land hatten, auf dem sie jagten und sammelten. Locke zufolge erwerben die Menschen nur durch die Landwirtschaft Eigentum, indem sie ihre Arbeitskraft mit dem Land, das sie bearbeiten, vermischen und dadurch Eigentum erlangen. Kant war da anderer Meinung:
„Handelt es sich bei diesen Menschen um Hirten oder Jäger (wie die Hottentotten, die Tungusi oder die meisten amerikanischen Indianernationen), die für ihren Lebensunterhalt auf weite offene Landstriche angewiesen sind, so kann die (fremde) Ansiedlung nicht mit Gewalt, sondern nur durch Vertrag erfolgen, und zwar durch einen Vertrag, der die Unwissenheit dieser Bewohner in Bezug auf die Abtretung ihres Landes nicht ausnutzt.“
Hier untergrub Kant nicht nur Lockes Eigentumstheorie, sondern prangerte auch die schamlose Ausbeutung von Völkern an, die, da sie keine Vorstellung von Privateigentum an Land haben, die Insel Manhattan für eine Handvoll Perlen abtreten könnten. Spätere Kritiker taten dieses Argument gegen den Siedlerkolonialismus als Beweis dafür ab, dass Kant nicht in der Lage sei, kulturelle oder historische Angelegenheiten zu beurteilen, da “primitive Völker” keine Rechtsvorstellungen hätten und daher nicht in der Lage seien, Verträge zu schließen.
Die Kritiker der Aufklärung haben nicht nur auf die Grausamkeit des Imperiums hingewiesen. Sie dekonstruierten auch die Theorien, mit denen der Raub von Land und Ressourcen der Ureinwohner gerechtfertigt werden sollte.
Wenn die besten Denker der Aufklärung den gewaltigen Diebstahl von Land anprangerten, der die europäischen Imperien ausmachte, was hielten sie dann von dem gewaltigen Diebstahl von Völkern? Die meisten verurteilten unmissverständlich die Sklaverei, auch wenn nicht alle sofort die Konsequenzen ihrer Ansichten erkannten. Aber viele prangerten auch die Mitschuld der Europäer an der Aufrechterhaltung der Sklaverei an, selbst derjenigen, die selbst keine Sklavenhalter waren. Voltaires Candide porträtiert einen Afrikaner in Surinam, dem nach seinem Fluchtversuch aus der Sklaverei ein Bein abgeschnitten wurde. “Das ist der Preis dafür, dass du in Europa Zucker isst”, sagt der versklavte Mann. Diderot geht noch weiter und meint, dass sich die Sklavenhalter weder durch Mitleid noch durch moralische Überlegungen bewegen lassen würden, und kommt zu dem Schluss, dass sich die versklavten Afrikaner mit Gewalt befreien müssen. Seine Prophezeiung, dass “ein großer Mann, ein schwarzer Spartakus” diese Befreiung schließlich anführen würde, inspirierte Toussaint L’Ouverture. Kant wandte sich gegen religiöse Behauptungen, die erfunden wurden, um die rassifizierte Sklaverei zu rechtfertigen; lange vor der amerikanischen Konföderation wurde behauptet, die Schwarzen stammten von Ham ab, jenem Sohn Noahs, der verflucht wurde, weil er die Blöße seines Vaters aufgedeckt hatte. Gegen diese zweifelhafte Theologie setzte Kant die Vernunft ein:
„Manche Menschen stellen sich vor, dass Ham der Vater der Mauren ist und dass Gott ihn als Strafe geschaffen hat, die nun alle seine Nachkommen geerbt haben. Allerdings kann man keinen Beweis dafür erbringen, warum die Farbe Schwarz passender als die Farbe Weiß das Zeichen eines Fluches sein sollte.“
Seltsamerweise wurde diese Passage in einen kürzlich erschienenen Band mit Schriften aufgenommen, die den Rassismus der Aufklärung aufdecken sollen. Der Herausgeber scheint nicht bemerkt zu haben, dass Kant ein Argument demontiert hat, das weiße, rassistische Christen bis heute unterstützen.
Ich habe nur an der Oberfläche der Beweise für die Verurteilung des Imperialismus durch die Aufklärung gekratzt, aber wie viele von Ihnen wissen, gibt es noch viel mehr. Wie konnte sich angesichts dieser Beweise der Mythos von der Unterstützung des Kolonialismus durch die Aufklärer durchsetzen? Ich fürchte, die Erklärung ist einfach. Wie alle fortschrittlichen Intellektuellen haben auch die radikalen Aufklärer nicht alle ihre Schlachten gewonnen. (Ich bin nicht für den Krieg gegen den Irak oder die Bombardierung des Gazastreifens verantwortlich, aber man könnte sagen, dass mein Widerstand gegen beides, auch wenn er früh und laut war und viel Energie gekostet hat, völlig nutzlos war). Obwohl Kant und andere das Denken ihrer Zeitgenossen in vielen Fragen veränderten, konnten sie den großen europäischen Drang nach einem Imperium nicht aufhalten, der im neunzehnten Jahrhundert seine volle Kraft entfaltete. Dieser Gedankengang geriet im Laufe des neuen Jahrhunderts in Vergessenheit, und selbst liberale Denker wie John Stuart Mill traten für gemäßigte Versionen des Imperialismus ein.
Doch wenn sie den Kolonialismus auch nicht stoppten, so gelang es ihnen doch, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, und ihre Ideen wurden zu Eckpfeilern für Toussaint Louverture und andere Antikolonialisten. Wie Jean-Paul Sartre schrieb:
Die Abstraktion von der Menschlichkeit ist prekär, leichter zu denken als zu handeln.
„Vor einigen Jahren fand ein bürgerlicher kolonialistischer Kommentator nur diese Worte zur Verteidigung des Westens: ‚Wir sind keine Engel. Aber wir empfinden zumindest ein gewisses Maß an Reue.‘ Was für ein Geständnis!“
Wäre ein schlechtes Gewissen alles, was die Denker der Aufklärung zu bieten hätten, würde Sartres Verachtung auch für sie gelten. Aber sobald Ideen ans Licht kommen, verlangen sie nach Verwirklichung. Die Römer hatten keine Gewissensbisse oder das Bedürfnis, ihr Imperium zu rechtfertigen. Sie sagten ihren Untertanen auch nicht, dass die Kolonisierung gut für sie sei. Neben besseren Schiffen und Waffen verfügten die Kolonisatoren des neunzehnten Jahrhunderts über etwas, das den früheren Imperialisten fehlte: das Bedürfnis nach Legitimität. Der indische Nationalist des neunzehnten Jahrhunderts, Aurobindo Ghose, drückte die Sache so aus:
„Die Vorstellung, dass Despotismus jeglicher Art ein Verstoß gegen die Menschlichkeit sei, hatte sich zu einem instinktiven Gefühl herauskristallisiert (…) Der Imperialismus musste sich vor diesem modernen Gefühl rechtfertigen und konnte dies nur tun, indem er vorgab, ein Treuhänder der Freiheit zu sein, der von oben beauftragt wurde, die Unzivilisierten zu zivilisieren.“
Dies ist leider der Ursprung der Legende, dass die Aufklärung den Kolonialismus sanktioniert hat. Wie Tzvetan Todorov schrieb,
“Die koloniale Expansion oder die “Aufteilung Afrikas” dem humanistischen Projekt des Exports der Aufklärung zuzuschreiben, bedeutet, das für bare Münze zu nehmen, was nur Propaganda war: ein meist ungeschickter Versuch, die Fassade eines Gebäudes zu ersetzen, das für einen ganz anderen Zweck errichtet wurde.”
Wie ist die Legende entstanden? Die Denker der Aufklärung prangerten den Kolonialismus an und vertraten die Ansicht, dass die Gerechtigkeit auf der Seite derjenigen außereuropäischen Nationen stehe, die potenzielle Eindringlinge töteten oder ihnen ihre Türen verschlossen. Ein halbes Jahrhundert später suchten die europäischen Imperialisten, als sie im Namen der Ideen, die sie für sich selbst wollten, mit einer starken Kritik konfrontiert wurden, nach Wegen, die Ideale der Freiheit und Selbstbestimmung im eigenen Land aufrechtzuerhalten, während sie sie im Ausland weiter verletzten. Ihre Lösung bestand darin, dass sie behaupteten, sie würden diese Ideale Völkern bringen, die sie aus eigener Kraft nicht verwirklichen konnten. Das Imperium, so argumentierten sie, sei eine Last, die sie um der Eingeborenen willen auf sich nehmen. Die Kolonialisten waren weit davon entfernt, mit den Gütern in Konflikt zu geraten, die sie für ihr eigenes Volk anstrebten – ein Ende von Hunger und Krankheit und Ungleichheit vor dem Gesetz -, sondern sie wollten diese Güter und das Christentum zu den benachteiligten Völkern bringen, die sie noch nicht entdeckt hatten. Rousseau und Diderot und Kant hätten den Betrug durchschaut – und weinten, als sie sahen, wie ihre eigenen Ideale in Ideologie verwandelt wurden. Aber der Raub war verlockend, und die Kritiker waren tot.
Jedes Argument gegen Sklaverei, Kolonialismus, Rassismus oder Sexismus ist in der Frage “Ist sie kein Mensch?” verkörpert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Teil der postkolonialen Kritik an der Aufklärung auf einem einfachen historischen Irrtum beruht. Das Neue im 18. Jahrhundert war nicht der Kolonialismus, sondern der Widerstand dagegen, ein Widerstand, der von aufklärerischen Denkern und aufklärerischen Prinzipien angetrieben wurde. Die Opposition verlor und der Kolonialismus dehnte sich aus – nun nicht nur durch schnellere Schiffe und stärkere Waffen, sondern auch durch die Unterstützung aufklärerischer Prinzipien, die als reine Propaganda instrumentalisiert wurden, wie Todorov sagte.
Aber es gibt noch einen anderen Teil der Kritik, der noch tiefer geht. Um noch einmal eine einfache Zusammenfassung von Ansichten zu geben, die in vielen Quellen zu finden sind, aber vielleicht am besten von Charles Mills artikuliert wurden: Die politische Theorie der Aufklärung, die ihr vorausging, ist objektiv rassistisch, weil sie sich nicht mit Rassismus auseinandersetzt. Wäre dies wahr, wäre der Universalismus der Aufklärung ein Schwindel. Indem sie von den Unterschieden zwischen Ethnie, Klasse und Nation abstrahierten, schrieben die Denker der Aufklärung ihre eigene Ethnie, Klasse und ihr Geschlecht (eine Kategorie, die sie nicht einmal in Betracht zogen) in die vermeintlich allgemeinen Prinzipien hinein. Die vermeintlich universellen Wahrheiten, Interessen und Vorlieben verdinglichten lediglich die Interessen und Vorlieben der männlichen Besitzenden. Die Abstraktion von jenen Merkmalen von Personen, die für Fragen der Gerechtigkeit als weniger bedeutsam angesehen werden, war eine verdeckte Art und Weise, eine bestimmte Ethnie und Klasse zu etwas so Transzendentem zu verdinglichen, dass es stillschweigend allen auferlegt wurde. Was an diesen Behauptungen wahr ist, ist die Tatsache, dass viele von uns, ohne daran erinnert zu werden, in der Tat eher dazu neigen, universell zu denken, weil sie weiß gefärbt sind und nicht braun, männlich und nicht weiblich, heterosexuell und nicht schwul. In diesem Punkt sind einige Initiativen zur Förderung der Vielfalt hilfreich.
Aber in unserer Eile, die Vielfalt zu erhöhen, haben wir vergessen, was für ein Kunststück es war, diese ursprüngliche Abstraktion auf die Menschheit zu übertragen. Frühere Annahmen waren von Natur aus partikular, so wie frühere Rechtsvorstellungen religiös waren. Aber die Idee, dass ein einziges Gesetz für Fürsten und Bauern, Protestanten und Katholiken, Juden und Muslime gelten sollte, einfach aufgrund ihrer gemeinsamen Menschlichkeit, ist eine neuere Errungenschaft, die unsere Annahmen heute so gründlich prägt, dass wir sie gar nicht mehr als Errungenschaft erkennen. Wir sollten diese Leistung der Abstraktion würdigen, selbst von jenen Denkern der Aufklärung, die nicht in der Lage waren, die gewaltige Errungenschaft zu erklimmen, die sie vollbracht hatten, und auf den Sprossen lokaler Vorurteile stecken blieben.
Betrachten wir auch das Gegenteil: Ansichten wie die von Carl Schmitt, der schrieb, dass “jeder, der das Wort ‘Menschlichkeit’ sagt, dich täuschen will”. Wie viele seiner Behauptungen war auch diese nicht originell. Er lehnte sich an den rechtsgerichteten Denker Joseph de Maistre an, der 1797 schrieb:
„Nun gibt es so etwas wie “den Menschen” auf dieser Welt nicht. In meinem Leben habe ich Franzosen, Italiener, Russen und so weiter gesehen. Ich weiß sogar, dank Montesquieu, dass man Perser sein kann. Aber was den Menschen betrifft, so erkläre ich, dass ich ihm nie begegnet bin.“
Man muss Europa zugute halten”, fährt er fort, “. dass es den gemeinsamen Intuitionen und Träumen der Menschheit einen formalen und institutionellen Ausdruck verliehen hat. Aber sprechen Sie dem Westen keine exklusiven Eigentumsrechte zu.
Schmitt ist wesentlich komplizierter, aber auch erschreckender. Schmitt suggeriert nämlich, dass universalistische Konzepte wie Humanität jüdische Erfindungen sind, die jüdische Interessen verschleiern sollen, die nach Macht in einer nicht-jüdischen Gesellschaft streben. Dieses Argument kommt dem heutigen Argument gefährlich nahe, dass der Universalismus der Aufklärung bestimmte europäische Interessen verschleiert, die in einer zunehmend nicht-weißen Welt nach Macht streben.
Keiner der beiden Kritiker der Gegenaufklärung hat erkannt, dass der Mensch kein empirischer Begriff ist, wie etwa der Hund oder der Franzose, den man nach ein oder zwei Augenblicken der Betrachtung ausmachen kann. Anstatt Schmitts berühmtes Zitat wiederzugeben, könnte man sagen: “Wer ‘Menschlichkeit’ sagt, erhebt einen normativen Anspruch.” Dahinter kann sich eine Formulierung wie der erste Satz des Grundgesetzes verbergen: “Die Würde des Menschen ist unantastbar.” Als Tatsachenbehauptung ist das lächerlich; die Worte wurden nur wenige Jahre geschrieben, nachdem das Dritte Reich die Menschenwürde in bis dahin unvorstellbarer Weise verletzt hatte. Was sie bedeuten, ist vielmehr zwingend: Jemanden als Menschen anzuerkennen, bedeutet, ihm eine Würde zuzugestehen, die es zu ehren gilt. Es bedeutet auch, dass diese Anerkennung eine Leistung ist: Die Menschheit in all ihren seltsamen und schönen Erscheinungsformen zu sehen, ist eine Leistung, die verlangt, dass man über den Schein hinausgeht. In diesem Sinne hat Foucault Recht, wenn er sagt, dass der Mensch eine neue Erfindung ist. Wie andere Produkte der Moderne schätzte er ihn nicht, und er erwartete, dass er verschwinden würde. “Unsere Aufgabe”, schrieb er, “ist es, uns vom Humanismus zu emanzipieren” – was voraussetzen würde, den Tod des Menschen zu akzeptieren, wie er in Die Ordnung der Dinge argumentierte.
Die Abstraktion von der Menschlichkeit ist prekär, leichter zu denken als zu handeln. Wenn die Anerkennung der Menschlichkeit eines Menschen bedeutet, dass man ihm das Recht zugesteht, mit Würde behandelt zu werden, dann verweigert man ihm seine Menschlichkeit, wenn man ihn versklavt oder ausrottet. Denken Sie an Schwarze, die wie Lasttiere behandelt werden, oder an Juden, die wie Ungeziefer behandelt werden. Während des Krieges in Vietnam war es üblich, amerikanische Kommentatoren feierlich erklären zu hören, dass Asiaten sich weniger um das Sterben sorgten als andere Menschen.
Die Denker der Aufklärung prangerten den Kolonialismus an und vertraten die Ansicht, dass die Gerechtigkeit auf der Seite derjenigen außereuropäischen Nationen stehe, die potenzielle Eindringlinge töteten oder ihnen ihre Türen verschlossen.
Die Wurzeln eines abstrakten Menschenbildes finden sich in jüdischen und christlichen Texten, die zumindest einige von uns als nach Gottes Ebenbild geschaffen betrachteten, aber die Abstraktion der Aufklärung beruhte auf der Vernunft und nicht auf der Offenbarung. Aus der Vorstellung, dass alle Menschen, ungeachtet ihrer Unterschiede, einen Anspruch auf Würde haben, nur weil sie Menschen sind, folgt kaum, dass ihre Unterschiede keine Rolle spielen. Individuelle Geschichten und Kulturen geben dem abstrakten Menschsein Fleisch auf den Knochen. Was daraus folgt, ist ein Anspruch auf gleiche Gerechtigkeit, die jedem Menschen garantiert werden sollte, unabhängig von der Geschichte, die er gelebt hat, oder der Kultur, in der er lebt.
Die Abstraktion zur Menschlichkeit erfordert den Einsatz der Vernunft, um über die Erscheinungen hinauszugehen, die uns Körper in verschiedenen Farben und Konfigurationen geben. Diese verkörperten Selbste, so betonen viele Postkolonialisten, sind natürlich und echt; die aufklärerische Vernunft, so wird behauptet, ist ein Instrument der Herrschaft, insbesondere der Herrschaft über die Natur. Leider verstärken Passagen der Dialektik der Aufklärung solche Ansichten, obwohl ich heute keine Zeit habe, sie zu diskutieren, sondern nur darauf hinweisen möchte, dass die Vorstellung, die Vernunft sei der Natur feindlich gesinnt, auf einer binären Opposition zwischen Vernunft und Natur beruht, die kein Denker der Aufklärung akzeptiert hätte. Die beiden stehen scheinbar im Widerspruch zueinander, denn die Fähigkeit der Vernunft zu fragen, was natürlich ist und was nicht, ist der erste Schritt zu jeder Form von Fortschritt. Ein Hauptziel der aufklärerischen Beschäftigung mit außereuropäischen Kulturen war die Infragestellung einer Vielzahl europäischer Institutionen. Ihre Autorität beruhte auf dem Beharren von Kirche und Staat, dass sie natürlich und daher unveränderlich seien. Im 18. Jahrhundert wurde als natürlich angesehen: Sklaverei, Armut, die Unterwerfung der Frau, feudale Hierarchien und die meisten Formen von Krankheiten. Bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein argumentierten englische Kleriker, dass Versuche, die irische Hungersnot zu lindern, gegen die göttliche Ordnung verstoßen würden. Die Denker der Aufklärung waren weder gegen die Natur noch gegen die Leidenschaft – zwei Themen, mit denen sie sich so intensiv beschäftigten wie mit keinen anderen. Aber sie wussten, wie oft Unterdrückung durch Behauptungen über eine angebliche natürliche Ordnung gerechtfertigt wird, und sie waren entschlossen, diese Behauptungen mit Hilfe der Vernunft einer strengen Prüfung zu unterziehen. Jedes Mal, wenn Sie argumentieren, dass eine wirtschaftliche, rassische oder geschlechtsspezifische Ungleichheit nicht unvermeidlich ist, setzen Sie Ihre Vernunft ein, um diejenigen in Frage zu stellen, die darauf bestehen, dass Ungleichheiten einfach ein Teil der Welt sind.
Wir müssen auch nicht bis ins 18. Jahrhundert zurückdenken, um die Radikalität und Bedeutung der Abstraktion von Ethnie, Klasse und Geschlecht zu erkennen. Stellen Sie sich vor, Donald Trump, Narendra Modi oder Benjamin Netanyahu würden sich bereit erklären, die Welt aus der Perspektive des kategorischen Imperativs zu betrachten – und sei es nur für eine Stunde! – , um zu sehen, dass diese Perspektive alles andere als leer oder ideologisch in dem Sinne ist, wie es Mills behauptet. Die Erklärung, dass “auch wir Menschen sind”, schrieb Jean-Paul Sartre, “liegt jeder Revolution zugrunde”. Das bedeutet nicht, dass Sartre den Menschen als körperlos betrachtete, sondern nur, dass die Abstraktion, die mit dem Übergang vom “Algerier” zum “Menschen” einhergeht, mit all den Rechten und Pflichten, die von “Franzosen” erwartet werden, keine Form der Unterdrückung sein muss, wie Postkolonialisten behaupten. Im Gegenteil, es kann der erste Schritt zur Befreiung sein: Jedes Argument gegen Sklaverei, Kolonialismus, Rassismus oder Sexismus ist in der Frage “Ist sie kein Mensch?” verkörpert. Der ghanaische Philosoph Ato Sekyi-Otu sagt, die Frage sei in seiner Muttersprache Akan ebenso zu Hause wie in Thomas Jeffersons Englisch. Sekyi-Oto hält es für eine Beleidigung, zu behaupten, die Idee des Menschen müsse aus Europa importiert werden, und argumentiert eindringlich mit der Philosophie der gewöhnlichen Sprache, dass Judith Butlers Behauptung, ein Kantianer sei in jeder Kultur zu finden, eine eurozentrische kulturelle Zumutung sei. “Es ist überhaupt keine Zumutung”, schreibt Sekyi Otu in seinem Buch Left Universalism, “unsere einheimischen Sprachen leisten diese Arbeit regelmäßig.” Er stützt sich auf die besten Erkenntnisse der Philosophie der gewöhnlichen Sprache und fordert uns auf, darauf zu achten, was Muttersprachler tun, wenn sie einen moralischen Anspruch begründen. “Man muss Europa zugute halten”, fährt er fort, “. dass es den gemeinsamen Intuitionen und Träumen der Menschheit einen formalen und institutionellen Ausdruck verliehen hat. Aber sprechen Sie dem Westen keine exklusiven Eigentumsrechte zu.”
Was früher als ad hominem abgetan wurde, nennt man heute Positionalität. Ich sage das zum Teil mit einem Augenzwinkern, weil ich denke, dass Positionalität weit überschätzt wird, aber manchmal ist es ein guter Weg, um zu überprüfen, ob man glaubt, dass etwas oder etwas anderes universell ist. Deshalb habe ich begonnen, nach Kritiken an den Grundannahmen der postkolonialen Theorie zu suchen, die von Menschen aus dem so genannten Globalen Süden stammen. Sie sind verbreiteter, als Sie denken; Sie können einige von ihnen auf der Konferenz “Aufklärung in der Welt” hören, die das Einstein Forum Ende August abhalten wird. Weil wir heute davon ausgehen, dass jeder aus dem Globalen Süden zur postkolonialen Theorie neigt, akzeptieren wir Lesarten von Texten, die von den Postkolonialen falsch dargestellt und verzerrt werden. Ich schließe also mit diesem Zitat:
“Es ist nicht die schwarze Welt, die mein Verhalten bestimmt. Meine schwarze Haut ist kein Aufbewahrungsort für bestimmte Werte. Der Sternenhimmel, der Kant in Ehrfurcht versetzte, hat uns längst seine Geheimnisse offenbart.” Schwarze Haut, weiße Masken
Prof. Dr. Susan Neiman,
ist eine US-amerikanische Philosophin und Schriftstellerin und seit dem Jahr 2000 Direktorin am Einstein Forum in Potsdam. Sie studierte Philosophie an der Harvard Universität und der Freien Universität Berlin. Als Professorin für Philosophie arbeitete sie an der Yale Universität und der Tel Aviv Universität. Sie hat ausführlich über Aufklärung, Moralphilosophie, Metaphysik und Politik geschrieben und mehrfach gezeigt, dass Philosophie eine lebendige Kraft für zeitgenössisches Denken und Handeln ist. Politisch setzte sie sich vor allem gegen das Vorgehen der USA im Vietnam- und Irakkrieg ein und engagierte sich als Wahlkampfhelferin für Barack Obama. Neiman war Mitglied des Institute für Advanced Study in Princeton, Fellow am Rockefeller Foundation Study Center in Bellagio, Italien, und Senior Fellow des American Council of Learned Societies.
Heute ist sie Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der American Philosophical Society. Sie ist Autorin von neun Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt wurden und unter anderem Preise von PEN, der Association of American Publishers und der American Academy of Religion gewonnen haben. Texte von ihr erschienen in der New York Times, der New York Review of Books, The Globe and Mail, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in vielen anderen Publikationen.