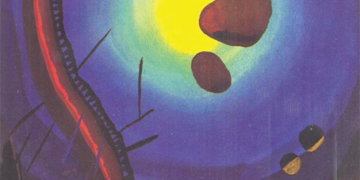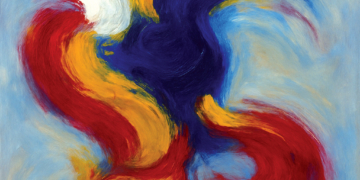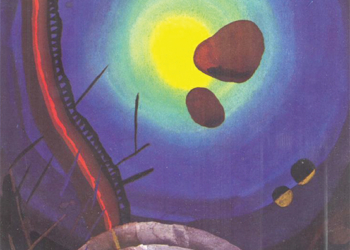Das Verhältnis von Moral und Gesetz ist Gegenstand endloser Debatten, in denen keine Entscheidung möglich zu sein scheint.
Von Versuchen, beides gemeinsam zu denken, über Ansätze, das eine mit dem anderen zu begründen, bis hin zu Überlegungen zu einer Hierarchisierung hat die Philosophie großartige intellektuelle Leistungen von großer Vielfalt hervorgebracht. Dieses bereits weite Feld wird noch größer – und gewinnt auch an praktischer Relevanz –, wenn wir auch die Frage in den Blick nehmen, inwieweit es einem idealer Vertrag moralischer Natur möglich ist, realistische Bedingungen für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben zu schaffen.
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
Da sich sehr viele Philosophinnen und Philosophen dieser Frage gewidmet haben, und eine umfassende Behandlung ihrer Werke den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, erscheint es zweckmäßig, sich auf einen der prominentesten Denker, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, zu beschränken: Immanuel Kant (1724-1804). Ausgehend von seinen Arbeiten zur Möglichkeit, dass das Rechtliche aus dem Moralischen erwächst und auf diese Weise friedliche Koexistenz und gesellschaftlichen Frieden hervorbringt, formulieren wir unsere These: Moralische Bedingungen können ein Zusammenleben in Frieden und in Übereinstimmung mit universellen Gerechtigkeitsprinzipen möglich machen.
1. Kants idealistische Überlegungen und deren empirischen Grundlagen
Um Kants Konzepte von Recht und Frieden zu verstehen, müssen wir uns mit seiner Vorstellung von der Natur des Menschen und dessen Naturzustand, dem er den bürgerlichen Zustand gegenüberstellt, auseinandersetzen. Relevant sind zudem die moralischen Forderungen, welche Kant an das menschliche Handeln stellt, und die Frage, inwieweit diese Elemente die objektiven bürgerlichen Bedingungen, die mit universalistischem Anspruch Frieden schaffen wollen, herstellen können.
Um dieses Denken zu verstehen, müssen wir uns mit seinem Konzept des „Naturzustands“, bei dem er zwei Formen unterscheidet, befassen. Kant unterscheidet zwischen den rechtlichen (oder juridischen) Naturzustand, dem er den rechtlich-bürgerlichen Zustand gegenüberstellt, und dem ethischen Naturzustand, dessen Gegenteil er als ethisch-bürgerlichen Zustand bezeichnet. Er geht davon aus, dass Individuen sowohl im rechtlichen als auch im ethischen Naturzustand dazu fähig sind, sich selbst Gesetze zu geben, auch wenn es in diesem Zustand keine allgemein anerkannte Instanz, der sich alle unterordnen, gibt. Jeder Mensch ist sein eigener Richter in dem Sinne, dass es keine allgemeine Gerichtsbarkeit, die über Macht zur Durchsetzung ihrer Urteile verfügt, existiert. Somit hat niemand das Recht, für alle gültige Pflichten festzulegen, und deren Erfüllung zu erzwingen2.
Das moralische Gesetz erfordert Gerechtigkeit, d. h. Glückseligkeit, die der Tugend entspricht, und nur die göttliche Vorsehung kann dies gewährleisten
Für Kant sind beide Formen des Naturzustand miteinander verflochten, wobei der rechtliche Naturzustand die Vorstellung eines Krieg aller gegen alle einschließt, und der ethische Naturzustand eine öffentlich zur Schau gestellte, wechselseitige Feindseligkeit der Tugendprinzipien bedeutet3. Hier tritt das moralische Gesetz auf dem Plan, das Russel wie folgt beschreibt: „Das moralische Gesetz erfordert Gerechtigkeit, d. h. Glückseligkeit, die der Tugend entspricht, und nur die göttliche Vorsehung kann dies gewährleisten … Es muss Freiheit geben, denn ohne sie kann es keine Tugend geben.”4 Kant geht also davon aus, dass der Naturzustand, als Zustand vor der politischen Organisation, kein Zustand des Friedens oder der Harmonie ist, sondern entweder bereits ein Kriegszustand ist, oder zumindest durch die ständige Möglichkeit eines Kriegs gekennzeichnet ist, wobei diesem eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Staaten zukommt5.
Aus diesen beiden Formen das Naturzustands kann ein bürgerlicher Zustand hervorgehen. Der bürgerliche Staat ist für Kant eine Organisationsform, in der das Gemeinwesen durch Gesetze geregelt ist, und welche durch das Befolgen von rationalen Prinzipien entsteht:
1. Das Prinzip der Freiheit: Jeder Einzelne in der Gesellschaft ist in erster Linie ein Mensch.
2. Das Prinzip der Gleichheit: Alle Mitglieder der Gesellschaft sind vor dem Gesetz gleich.
3. Das Prinzip der Selbstständigkeit: Jeder Einzelne wird zum Bürger indem er seine Freiheit und Gleichheit vor anderen erlangt. Er stützt sich dabei nur auf sich selbst und seine Freiheit. Das Prinzip der Gleichheit bestimmt hierbei, wie er andere behandelt und andere ihn behandeln6.
4. Das Prinzip der rechtlich-bürgerlichen Persönlichkeit: In Rechtsangelegenheiten darf kein Bürger an Stelle eines anderen Bürgers handeln7.
2. Politik und Geschichte: Die Dialektik des Idealen und des Realen
Für die Präsentation seiner politischen Theorien wählt Kant entweder sein Rechtsverständnis oder seine Geschichtsphilosophie als Ausgangspunkt,8 wobei letztere eine Philosophie des unausweichlichen Fortschritts ist. Hierunter versteht Kant eine von der Natur, dem Schicksal oder der Vorsehung bestimmte, historischen Notwendigkeit, gemäß derer sich der Mensch zu verhalten habe 9. Seine Geschichtsphilosophie ist der Versuch, die Trennung zwischen Moral und Politik zu überwinden, indem sie Wege des Fortschritts hin zu dem Rechtssystems, das die erwartete Synthese zwischen Politik und Moral verwirklicht, aufzeigt10. Kant glaubt also an ein Projekt für die Menschheit, das durch den rationalen, bewussten Willen des Menschen in einem Bündnis mit der Natur verwirklicht werden kann11.
Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen.
Neben der Geschichtsphilosophie stützt sich Kant für seine politischen Theorien auch auf seine Konzepte von Recht und Gesetz. Seine politische Philosophie beruht auf der Annahme, dass der unabhängige Vernunftgebrauch auf der Grundlage der Freiheit die Quelle des politischen Rechts darstellt. Unter Anwendung einiger Regeln des richtigen Denkens, unterwirft das Gericht der Vernunft politische Positionen einer kritischen Prüfung und versucht so, die grundlegenden Prinzipien der Politik zu definieren”12. Kant bringt die Rolle der Geschichtsphilosophie und die Rolle des Rechts bei der Hervorbringung des Politischen wie folgt in Einklang: „Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen, […] mithin kann es keinen Streit der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen, aber theoretischen (mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben.“13
Die Ethik repräsentiert also den theoretischen Aspekt, wohingegen die Politik den praktischen Aspekt repräsentiert, wobei es sich in beiden Fällen um rechtliche Aspekte handelt. Somit arbeitet die Politik für einen rechtlichen Vertrag und die Bildung eines Konsenses, „weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille (in einem Volk, oder im Verhältniß verschiedener Völker unter einander) ist, der allein, was unter Menschen rechtens ist, bestimmt; diese Vereinigung des Willens aller aber, wenn nur in der Ausübung consequent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der Natur zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effect zu verschaffen. – So ist es z. B. ein Grundsatz der moralischen Politik: daß sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle, und dieses Princip ist nicht auf Klugheit, sondern auf Pflicht gegründet.”14 Diese moralische Pflicht erfordert die Existenz von Gesetzen, mithin also das Verlassen des rechtlichen Naturzustands.
Hier wird deutlich, wie zentral der Begriff der Freiheit des Menschen, eines rationalen Wesens, für Kants politische Philosophie ist. Es geht ihm darum, wie eine solche Freiheit gestaltet werden könne, um die Untersuchung der „Fähigkeit des Einzelnen, moralische Gesetze aufzustellen und diese Gesetze anzuwenden; das bedeutet, dass grundsätzlich jeder Mensch jedem gleich ist. Gesetzlich verbriefte Rechte und politische Institutionen müssen darauf abzielen, diese Freiheit und Gleichheit zu schützen“15. Daher stellt Kant Rechtsgebote auf, die Ausgangspunkte menschlichen Handelns und Grundsätze für das friedliche Zusammenleben von Individuen und Gruppen sind:
1. Das Gebot der Integrität: Der Mensch soll seinen Wert im Umgang mit Anderen bekräftigen, in Sinne von: „Mache Dich nicht bloß zum Mittel für andere, sondern sei ihnen zugleich ein Zweck“. Das ist ein jeder Person innewohnendes Recht.
2. Das Verbot, Leid zuzufügen: Hierbei unterstreicht Kant, dass diese gesetzliche Pflicht selbst dann gilt, wenn zu ihrer Einhaltung der Abbruch aller zwischenmenschlichen Beziehungen und eine vollständige Isolation notwendig ist.
3. Das Gemeinschaftsgebot: Jede Form von zwischenmenschlicher Interaktion soll in einer Weise geschehen, die es uns erlaubt, unsere Integrität zu bewahren, also unsere Identitäten und Überzeugungen beizubehalten.
Bei seiner Systematisierung des Rechts unterscheidet Kant zwischen dem Recht als Wissenschaft und dem Recht als einem Werkzeug, dem Menschen Pflichten aufzuerlegen. Als Wissenschaft unterteilt Kant das Recht in Naturrecht, das auf apriorischen Prinzipien beruht, und positives Recht, das von Gesetzgebern erlassen wird. Als Werkzeug, Menschen Pflichten aufzuerlegen, unterteilt er das Recht in angeborenes und erworbenes Recht, wobei das erste zu der Phase vor der politischen Organisation gehört, und das zweite zu der Phase danach. Rechtsbeziehungen gibt es nur zwischen Menschen, entweder in einer natürlichen Gesellschaft, wo diese Rechtsbeziehungen aus der menschlichen Freiheit entstehen und privates Recht genannt werden, oder in einer bürgerlichen Gesellschaft, wo sie aus der Errichtung einer politischen Gemeinschaft entstehen und öffentliches Recht genannt werden16.
Wir können also feststellen, dass „die kantische Metaphysik des Rechts sich nicht auf eine systematische Konstruktion der Prinzipien, auf welchen das Recht, das politische Handeln, der Staat und die öffentlichen Freiheit – um nur einige zu nennen – beruht, beschränkte, sondern vielmehr eine Positionsbestimmung des politischen Denkens in der westlichen Welt darstellte. Es handelte sich um den Versuch, den Westen auf diesen Prinzipien zu begründen, ausgehend von einer tiefgehenden Analyse der politischen Problematik […] Es war der Moment, in dem die politische Moderne ein gewisses philosophisches Bewusstsein erlangte, das es möglich machte, Konzepte wie Staat, Regierungsführung, Macht und Menschenrechte neu zu denken.“17
Das einzige natürliche Recht ist also die Freiheit, und zwar in dem Maße, in dem sie es uns ermöglicht, mit unseren Mitmenschen zusammenzuleben. Hierbei handelt es sich um ein Recht, das uns zusteht, weil wir Menschen sind, also aufgrund unserer Menschlichkeit. Dieses Recht schließt die natürliche Gleichheit, die „Selbstständigkeit“, mit ein: Der Mensch ist gegenüber seinen Mitmenschen durch die gleichen Bestimmungen gebunden, die auch diese ihm gegenüber binden. Es kann keine Ungerechtigkeit geben, solange noch keine Gesetze erlassen sind, weil es ohne diese keine unrechten Taten gibt. Abgesehen von dieser Freiheit gibt es kein natürliches, „angeborenes“ Recht; alle andere Rechte sind erworben, da sie sich aus der Beziehung zu Anderen innerhalb eines gesetzlich definierten Rahmens ergeben18, was bedeutet, dass die vielfältigen Errungenschaften des bürgerlichen Zustands mit einer partiellen Aufgabe von Freiheit erkauft werden.
3. Die bürgerliche Gesellschaft und ihre Errungenschaften, die friedliches Zusammenleben ermöglichen
Oben haben wir über den rechtlichen und den ethischen Naturzustand gesprochen, und über ihre Entsprechungen, den rechtlichen-bürgerlichen und den ethisch-bürgerlichen Zustand. Den rechtlichen-bürgerlichen Zustand definiert Kant als: „das Verhältniß der Menschen untereinander, so fern sie gemeinschaftlich unter öffentlichen Rechtsgesetzen (die insgesammt Zwangsgesetze sind) stehen“19. Der moralische Zivilisationszustand ist der, „da sie unter dergleichen zwangsfreien, d. i. bloßen Tugendgesetzen vereinigt sind.“20 Insofern sind Zwangsgesetze für die politische Organisation notwendig und die Moral kann nicht an ihrer Stelle treten, weil diese per Definition frei und sie zu erzwingen unmöglich ist. Moralisches Handeln bleibt also trotz der politischen Organisation frei.
Angesichts der zentralen Rolle der Gesetze stellt sich die Frage, inwieweit diese moralisch derart verbindlich sein können, so dass sie nicht gebrochen werden können. „Auch wenn der Mensch Kraft seiner praktischen Vernunft in der Lage ist, die Notwenigkeit von Gesetzen und ihrer allgemeinen Anwendung einzusehen, so neigt er doch dazu, sich selbst von dieses Gesetzen auszunehmen um seine Wünsche zu befriedigen.“21 Ausgehend von der drohenden Möglichkeit des Krieges erscheint Kant die Notwendigkeit, Gemeinschaft und Zusammenleben zu ermöglichen, offensichtlich. Es handelt sich um die einzige Möglichkeit, wenn wir uns nicht von unseren individuellen Wünschen beherrschen lassen wollen, was in Form eines egoistischen Individualismus unser Untergang sein könnte.
Jede Gattung vernünftiger Wesen ist objectiv, in der Idee der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke bestimmt.
Ausgehend von dem bereits erwähnten Naturzustand, in dem es kein Gesetz und keine Herrschaft, der sich alle unterwerfen, gibt, argumentiert Kant: „Jede Gattung vernünftiger Wesen ist nämlich objectiv, in der Idee der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, nämlich der Beförderung des höchsten als eines gemeinschaftlichen Guts, bestimmt. Weil aber das höchste sittliche Gut durch die Bestrebung der einzelnen Person zu ihrer eigenen moralischen Vollkommenheit allein nicht bewirkt wird, sondern eine Vereinigung derselben in ein Ganzes zu eben demselben Zwecke zu einem System wohlgesinnter Menschen erfordert, […] als einer allgemeinen Republik nach Tugendgesetzen […]“22.
Die Überlegungen von Hobbes, Locke und Rousseau zu Naturzustand und Gesellschaftsvertrag lehnt Kant aus verschiedenen Gründen ab, etwas dass der gedachte Vertrag die Rechte des Einzelnen anderen gewähre, wobei diese Rechte aber unveräußerlich seien. Für Kant besteht der politische oder bürgerliche Zustand einerseits in der Beziehung der Individuen eines Volkes untereinander, sowie in der Beziehung der Gesamtheit dieser Individuen zu der Person des „Staats“. Dieser Staat wird auch als das „Gemeinwohl“ bezeichnet, da er das gemeine Interesse Allee innerhalb eines gegebenen rechtlichen Rahmens vertritt. In seiner Beziehung zu anderen Völkern wird der Staat als „Macht“ bezeichnet, wobei ihn Kant definiert als: Vereinigung einer großen Zahl von Menschen unter legitimen Gesetzen, so dass diese Gesetze a priori notwendig sind, das heißt, dass sie auf natürliche Weise aus den Begriffen des äußeren Rechts (d. h. Freiheit, Gleichheit und Selbstständigkeit) hervorgehen.
gegebenen rechtlichen Rahmens vertritt. In seiner Beziehung zu anderen Völkern wird der Staat als „Macht“ bezeichnet, wobei ihn Kant definiert als: Vereinigung einer großen Zahl von Menschen unter legitimen Gesetzen, so dass diese Gesetze a priori notwendig sind, das heißt, dass sie auf natürliche Weise aus den Begriffen des äußeren Rechts (d. h. Freiheit, Gleichheit und Selbstständigkeit) hervorgehen.
Allein das Volk hat das Recht, Gesetze zu erlassen, denn es könne sich selbst keinen Schaden zufügen,23 während ein Einzelner, wenn er Gesetze für andere erlässt, anderen Schaden zufügen kann. Niemand will sich selbst Schaden zufügen, und wenn das Volk Gesetze erlässt, will es sich selbst keinen Schaden zufügen . Diese Forderung verbindet Kant mit der Gründung der politisch-moralischen Gemeinschaft. Diese müsse alle Individuen einer allgemeinen Gesetzgebung werfen, und diese Gesetze, die das Verhältnis zwischen ihnen regeln, müssen als Anordnungen oder Gebote eines allgemeinen Gesetzgebers (dieser Gruppe) angesehen werden können. Wenn es sich bei der zu gründenden Gruppe um eine Rechtsgemeinschaft handelt, dann soll die zu einem Ganzen vereinte Öffentlichkeit selbst der Gesetzgeber der Verfassungsgesetze sein24. Allerdings geht die Gründung der bürgerlichen Rechtsgemeinschaft nicht mit Zwangsgesetzen für die moralische Gemeinschaft einher, denn Kant glaubt, dass diese moralische Gemeinschaft nur als eine göttlichen Befehlen folgende Gruppe denkbar ist. Das bedeutet, dass diese Gruppe das Volk Gottes in Sinne der Natur der Tugend wäre25. Nach Kants Überlegungen zur Entstehung des Staates aus dem bürgerlichen Zustand heraus, stellt er dessen Errungenschaften im Bereich des positiven Rechts heraus, wobei das Konzept der Staatsbürgerschaft hierbei an erster Stelle steht. Alle Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind Rechtssubjekte.
Ausgehend von der Politik- und Moralphilosophie Kants „schließt das Konzept einer bürgerlichen Regierung, die auf apriorischen Vorstellungen der praktischen Vernunft basiert, also auf Freiheit, Gleichheit und Selbstständigkeit, die Begriffe Mensch, Untertan und Bürger ein. Jedes Individuum genießt Freiheit im Rahmen des Gesetzes als Mensch, Gleichheit vor dem Gesetz als Untertan und eine Rechtspersönlichkeit als Bürger“26.
Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt.
Eine bürgerliche Regierung hat nicht das Recht, sich in Fragen des Glücks, der Moral und der Religion einzumischen, da ihre einzige Aufgabe darin besteht, das Gesetz durchzusetzen, um den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren und die Freiheiten jedes Individuums zu schützen. Denn ein guter Bürger muss nicht im moralischen Sinne gut sein, sondern lediglich nach den Gesetzen der Gesellschaft leben27. Ausgehend von der menschlichen Fähigkeit, Gemeinschaften zu bilden, die auf gemeinsamen Interessen und geteilten apriorischen Moralvorstellungen basieren, welche wiederum demokratische Systeme begründen, die zur Herausbildung von Konsens und dem Streben nach dem Gemeinwohl fähig sind, übt Kant Kritik an autoritären Herrschaftsformen. Insbesondere lehnt er Platons Konzept der Herrschaft der Philosophen ab: „Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völker die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich.”28 Laut Kant besteht die Aufgabe der Philosophen also darin, zu beobachten, zu kritisieren und zu bewerten, aber eben nicht im Führen der Regierungsgeschäfte.
Bei seiner Systematisierung der Regierungssysteme unterscheidet Kant drei Herrschaftstypen:29
1. Das autokratische System, in dem eine einzelnen Person herrscht.
2. Das aristokratische System, in dem die höchste Macht in den Händen einer kleinen Anzahl von Bürgern konzentriert ist.
3. Das demokratische System, in dem jeder über jeden herrscht, welches die Form einer Republik annehmen kann.
Jedes Herrschaftssystem, dessen Funktionieren von den Personen, die in Machtpositionen sind, abhängt, ist diskreditiert, da sich diese als Herren über die anderen aufschwingen und eine Art von Tyrannei erschaffen können. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Macht in den Händen einer einzelnen Person, einer Gruppe oder der Mehrheit liegt. Die Lösung besteht in dem von Kant bevorzugten republikanischen System, denn es handelt sich bei diesem um „die rationale Form des Staates […] da er unverändert weiter besteht, nur die Personen wechseln. Er hängt nicht von einer bestimmten Person ab, sondern bleibt Zweck jedes öffentlichen Rechts. Kennzeichnende Merkmale des republikanischen Systems sind die Gewaltenteilung und die parlamentarische Vertretung“30.
Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.
Kant formuliert diese Position wie folgt: „Man kann daher sagen: je kleiner das Personale der Staatsgewalt (die Zahl der Herrscher), je größer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republikanism, und sie kann hoffen, durch allmähliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich anders als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen.“31 Somit ist ein politisches System mit Gewaltenteilung um so republikanischer, je kleiner die Anzahl der Herrscher und je größer die Repräsentation des Volkes ist.
Ein weiteres wichtiges Element von Kants politische Philosophie ist die „Präferenz für die Mehrheit“, ein Prinzip „durch das die Interessen einiger, wenn nötig, denen anderer geopfert werden können. Wenn es eine Ethik des Regierens geben soll, darf die Regierung nur genau einen Zweck haben, und der einzige Zweck, der mit Gerechtigkeit vereinbar ist, ist das Gemeinwohl. […] So interpretiert, kann das Prinzip als eine ethische Grundlage für die Demokratie angesehen werden.“32 Hierin liegt der Grund für Kants sowohl implizite als auch explizite geäußerte Vorliebe für die republikanische Staatsform, da sie der Demokratie eine moralische Dimension verleiht: Durch Freiheit und Gewaltenteilung wird die Republik verwirklicht.
4. Frieden als Ziel des moralischen Gesetzes
Der Mensch ist von Natur aus bürgerlich, weil er immer Mitglied einer Gesellschaft ist. Nach Kant sollte diese Gesellschaft aber nicht in ihren barbarischen Naturzustand verharren, sondern sich in einer Form organisieren, die es jedem Einzelnen ermöglicht, seine Freiheit auszuüben und seine moralischen Ziele zu erreichen. Die Grundsätze des Rechts und der Gesetzgebung sind der Garant dieser Organisationsform. Aber egal wie fortgeschritten die Organisationsform eines Staates auch sein mag, bleibt die Freiheit doch immer bedroht, da neben ihm noch viele andere Staaten existieren, von denen manche Gewalt als legitimes Mittel in zwischenstaatlichen Beziehungen ansehen. Der Fortbestand der bürgerlichen Gesellschaft ist also nie ganz gesichert. Insofern kommen Völkergesetzen und Friedensverträgen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Sicherheitsstrategien zu33. Deshalb ersinnt Kant ein Projekt gegen die Idee des Krieges, das er „das Projekt des ewigen Friedens“ nennt. Er geht davon aus, dass rationale Überlegungen zwangsläufig zu einer bedingungslosen Verdammung des Krieges führen müssen. Kriege verhindern könne aber alleine eine Weltregierung, weshalb er zur Gründung eines Staatenbundes aufruft, in dem sich freie Staaten durch eine Charta verpflichten, keine Kriege mehr zuführen34.
Für sein Projekt des ewigen Friedens formuliert Kant sowohl Gebote als auch Verbote, wobei erstere lauten:35
1. „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“
2. „Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.“
3. „Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören“, weil sie den dauerhaften Frieden gefährden.
4. „Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden“, denn diese befördern Kriege und können zum Staatsbankrott führen.
5. „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig einmischen.“
6. „Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen“, denn das Ziel des Krieges muss darin bestehen, Frieden zu schaffen.
Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.
Neben den genannten Verboten formuliert Kant auch folgende Gebote:36
1. „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, was bedeutet, dass die Entscheidung, einen Krieg zu führen, von der Legislative, die das Volk vertritt, getroffen wird. Diese Regierungsform ist am ehesten geeignet, die Prinzipen von Freiheit und Gleichheit umzusetzen und den Frieden zu sichern.
2. Das Völkerrecht oder das internationale öffentliche Recht soll sich auf ein Bündnis freier Staaten stützen, in den Sinne, dass es darauf abzielt, diese Staaten in einem friedlichen Bund zu vereinen.
3. „Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein”, was die rechtliche Lage von Ausländern beschreibt.
Dies sind die Gebote und Verbote, die Kant für seinen „ewigen Frieden“ formuliert, und die Geschichte hat gezeigt, dass ein solches Friedensprojekt und der vorgeschlagene Staatenbund möglich sind. Die in dem Projekt beinhaltete Bändigung des menschlichen Verhaltens, sowohl als Individuen und als Gemeinschaften, erscheint als ein utopisches Unterfangen, weshalb es Kant wichtig ist, „dass Philosophen die Aufgabe übernehmen, den Bürgerinnen und Bürger den rechten Weg zu weisen und sie zu bilden, indem sie ihre Verstandeskräfte zum allgemeinen Wohl einsetzen, wie er in bereits in seinem Essay ‘Was ist Aufklärung?’ gefordert hat. […] Hierbei handelt es sich um den Versuch, das moderne Konzept von Staatsbürgerschaft zu umreißen.“37
Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.
Kant hat viel über die Grundlagen der “politischen Ethik” – wenn wir diese Bezeichnung verwenden wollen – geschrieben, wobei das folgende Zitat die verschiedenen Element seiner Theorie zusammenfasst: „Die formale Bedingung, unter welcher die Natur diese ihre Endabsicht allein erreichen kann, ist diejenige Verfassung im Verhältnisse der Menschen untereinander, wo dem Abbruche der einander wechselseitig widerstreitenden Freiheit gesetzmäßige Gewalt in einem Ganzen, welches bürgerliche Gesellschaft heißt, entgegengesetzt wird; […] Zu derselben wäre aber doch […] noch ein weltbürgerliches Ganze, d. i. ein System aller Staaten, die auf einander nachtheilig zu wirken in Gefahr sind, erforderlich. In dessen Ermangelung […] ist der Krieg […] unvermeidlich.“38 Hier wird das große Bild deutlich, wie sich der Horizont für die Organisation menschlicher Gemeinschaften durch einen politisch-ethischen Vertrag zum Erreichen des bürgerlichen Zustandes, sowohl lokal, als auch global-universellen, verändert, was neue Wege der Zusammenarbeit, der Solidarität und des Friedens eröffnet. Ausgehend hiervon können wir über Rawls Vorbedingungen zum Gesellschaftsvertrag diskutieren, über praktische Solidarität in der Gesetzgebung sowie die Frage, wie sich diese Überlegungen in einen universellen Diskurs übersetzen lassen, der zu einer Wiederentdeckung der kantschen Ideen führen und ihre Aktualität erhalten könnte.
5. Kants Bedeutung heute
Wie können wir Kants Denken in der arabischen Welt wiederentdecken, sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht? Diese Frage stellt sich insbesondere vor dem Hintergrund des relativ geringen Stellenwerts, den die Philosophie dort genießt, trotz der ihr innewohnenden Möglichkeit zu Veränderung, Befreiung und Heilung. Diese Problematik erschwert das Nachdenken über die Lage der arabischen Länder.
Vielleicht sind Kants Ideale und die Besonderheiten seines moralischen Systems der Ansatzpunkt, ihn für die arabische Welt wieder aktuell zu machen, gibt es in diesem Bereich doch große Schnittmengen mit der intellektuellen Tradition des Islams. Zu nennen wären hier beispielsweise die Pflichtethik, die Tendenz, das Recht universell zu denken, sowie der diskursive Allgemeingültigkeitsanspruch, der sich in vielen Koransuren in der Anrede „O ihr Menschen“ ausdrückt. Diese Elemente haben in vielen islamischen Richtlinien und Gesetzen verbindlichen Charakter.
Aber die Schnittpunkte liegen nicht nur im Bereich der Theorie, auch mit der geschichtlich belegten Regierungspraxis gibt es Überschneidungen. So sind die islamischen Kalifate ein Beispiel für die Schaffung einer moralischen und intellektuellen Atmosphäre, die ein friedliches Zusammenleben befördert, was allerdings nicht bedeutet, dass die arabische und islamische Geschichte reich an solchen Beispielen wäre – sie waren selten, um nicht zu sagen: Einzelfälle. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Wiederbelebung des kantschen Diskurses so schwer, dass wir kaum an diese Möglichkeit glauben können, was aber nicht heißt, dass diese nicht besteht.
Bis heute sind die von politischen Krisen erschütterten arabischen Ländern noch immer im Prozess der Staatsgründung gefangen und weder wirklich unabhängig noch wirklich souverän. Dieses Problem der Unabhängigkeit, der Staatsgründung und des rationalen politischen Systems sind eine Realität, die wir uns mit Kant theoretisch nähern können.
Das Problem der Staatsgründung und des kantschen Vertrags besteht darin, eine Wahl in Kants Sinne zu treffen, die Individuen Rechte gewährt und es ihnen ermöglicht, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden, was direkt zu der kontroversen Frage des Selbstbestimmungsrechts der Völker, über welches sie unabhängig vom Willen der Großmächte verfügen, führt.
Zur Frage des politischen Systems und der Herausbildung desselben schlägt Kant die Form der Republik mit Gewaltenteilung vor und verurteilt die Diktatur als eine irrationale Herrschaftsform.
Bei der Frage, wie ein friedliches Zusammenleben und ein kant‘scher Frieden in den arabischen Ländern verwirklicht werden kann, so ist die Herausforderung zuallererst intellektueller Natur. Die arabischen Gesellschaften müssen die Tatsache akzeptieren lernen, dass die Menschheit plural und divers ist. Jeder Versuch, dies zu leugnen, unterstützt einen terroristischen Diskurs, der die Gesellschaft und Staat untergräbt und ein intellektuelles Umfeld schafft, in dem kein rationales, demokratisches System entstehen kann. Daher ist der gesellschaftliche Frieden der erste Schritt hin zu einem globalen Frieden, und sei es auch nur ein kleiner.
6. Schluss
Kant verdanken wir die moralischen Grundlagen, die einer Philosophie des Handelns vorangehen, sowie das Konzept eines Vertrages zwischen den Völkern, der den Traum von Solidarität und einem Leben in Sicherheit verwirklichen könnte. Diese Vorstellungen sind allerdings so idealistisch und abstrakt, dass sie in der politischen und gesellschaftlichen Realität noch nicht verwirklicht werden konnten – was der Größe seiner intellektuelle Leistung keinen Abbruch tut. Allerdings folgt hieraus, dass das zentrale Anliegen bei der Wiederentdeckung von Kants Ideen darin bestehen muss, ihre praktische Umsetzung möglich zu machen. Dies ist ein Unterfangen, an dem sich Rawls mit seiner beeindruckenden Fähigkeit zur Theoriebildung versuchte, indem er das Konzept des in einem (hypothetischen) Urzustand geschlossenen Vertrags einführte. Allerdings blieb dieses Konzept ein Gedankenexperiment, das weder zu Frieden innerhalb noch zwischen Gesellschaften führte. Er blieb Gefangener einer anderen Form von Idealismus, der sein Projekt als Ganzes zum Scheitern verurteilte. Bei seinen Überlegungen zu dem, was sein soll, vernachlässigte er, was ist.
Jedes Nachdenken über die apriorischen Voraussetzungen eines Gesellschaftsvertrags muss die Form realistischer Bedingungen annehmen, andernfalls ist es nur ein Gedankenspiel, denn was ein Fundament für die Wirklichkeit sein soll, muss von einer Analyse der Wirklichkeit und den in ihr gegebenen Möglichkeiten ausgehen. Ideen, die nicht realisiert verwenden können, sind hierbei nicht hilfreich. Denn so ehrenwert auch jedes Streben nach Frieden innerhalb und zwischen Gesellschaften ist, so schwierig ist es auch, diesen Zustand in unserer Welt heute zu bewahren, wenn er denn einmal besteht. Und wie viel schwerer ist es noch, ihn erst herzustellen?
In einer Welt, die von terroristischem Fundamentalismus in extremistischer Form verwüstet wird, erscheint der gesellschaftliche Frieden als ein sehr fernes Ziel, das wir vielleicht niemals erreichen werden. Aber wenn es uns gelingen sollte, dann sicher nicht mit Vorstellungen von Begriffen wie „Pflicht“ und „Vertrag“ die nur unter den Bedingungen eines gedachten Idealzustandes funktionieren. Vielmehr müssen wir von den Normalbedingungen unserer Realität, die durch Gewalt, Pluralität, Klassenunterschiede und -kämpfe sowie gesellschaftliche Probleme gekennzeichnet ist, ausgehen.
Quellenverzeichnis:
- I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft (1788); in: Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900, AA, V, S. 161.
- I. Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793); in: AA, VI, S. 95
- Ibid., S. 96f.
- B. Russel: History Of Western Philosophy (1946). S. 736: „The argument is that the moral law demands justice, ie. happiness proportional to virtue. Only Providence can insure this, and has evidently not insured it in this life. Therefore there is a God and a future life; and there must be freedom, since otherwise there would be no such thing as virtue“.
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795); in: AA, V. S. 39. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- I. Kant: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793); in: AA, V, S. 290.
- A. Badawi: Immanuel Kant: Philosophie des Rechts und der Politik (1979). S. 95
- P. Hassner: Immanuel Kant (1987). S. 17. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795). S. 37. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- P. Hassner: Immanuel Kant (1987). S. 186. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- J. Touchard: Histoire des Idees Politiques (1959). S. 381. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- A. Al-Mahmoudi: Kant’s Political Philosophy, Political Thought in the Realm of Theoretical and Moral Philosophy (2008). S. 206. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795); in: AA, V. S. 370.
- Ibid., S. 378.
- N. Gilje und G. Skirbekk: A History of Western Thought. From Ancient Greece to the Twentieth Century (2001), S. 597. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- A. Badawi: Immanuel Kant: Philosophie des Rechts und der Politik (1979). S. 31f
- A. Munsif: Die Metaphysik des Rechts und die politische Begründung in der Moderne (2009), S.83
- A. Badawi: Immanuel Kant: Philosophie des Rechts und der Politik (1979). S. 33
- I. Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793); in: AA, VI, S. 95.
- Ibid.
- I. Musaddiq: Die historische Mission der kritischen Philosophie (2009). S . 16.
- I. Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793); in: AA, VI, S. 97.
- Ibid. S. 95 [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- Ibid. S. 196 [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- Ibid. S. 170 [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- A. Al-Mahmoudi: Kant’s Political Philosophy, Political Thought in the Realm of Theoretical and Moral Philosophy (2008). S. 181. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- Ibid.
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795). S. 369.
- A. Badawi: Immanuel Kant: Philosophie des Rechts und der Politik (1979). S. 123f.
- Ibid.
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795). S. 353.
- B. Russel: History Of Western Philosophy (1946). S. 738: „The difficulties are particularly obvious in political philosophy, which requires some principle, such as preference for the majority, by which the interests of some can, when necessary, be sacrificed to those of others. If there is to be any ethic of government, the end of government must be one, and the only single end compatible with justice is the good of the community. […] So interpreted, the principle may be regarded as giving an ethical basis for democracy.“
- U. Amin: Einleitung zur arabischen Übersetzung von „Zum ewigen Frieden“. S. 11.
- I. Kant: Zum ewigen Frieden (1795). S. 29. [A.d.Ü.: Die Seitenzahl bezieht sich auf die arabische Übersetzung]
- Ibid., S. 343ff.
- Ibid., S. 349ff.
- U. Al-Maskini: Kant heute: Oder der Mensch in den Grenzen der bloßen Vernunft (2006). S. 197.
- I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft (1788); in: AA, V, S. 432.
Weiterführende Literatur:
- Kant, Immanuel (1793): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.
- Badawi, Abd al-Rahman (1979). Immanuel Kant: Philosophie des Rechts und der Politik. Kuwait: Agentur für Druckpublikationen. [Arabisch]
- Touchard, Jean: Histoire des Idees Politiques (1959). Paris: P.U.F. [Arabische Übersetzung: Ali Muqalled (1987), Beirut: Internationaler Verlag für Druck und Publikation]
- Kant, Immanuel (1788). Kritik der praktischen Vernunft. [Arabische Übersetzung: Ghanem Hana (2007). Beirut: Arabische Organisation für Übersetzung.]
- Kant, Immanuel (1795). Zum ewigen Frieden. [Arabische Übersetzung: Uthman Amin (2007). Beirut: Dar al-Mada]
- Al-Mahmoudi, Ali (2008). Kant’s Political Philosophy, Political Thought in the Realm of Theoretical and Moral Philosophy. Negahe Moaser Publication. [Farsi] [Arabische Übersetzung: Abdorrahman al-Alavi (2007). Beirut: Dar Al-Hadi]
- Al-Maskini, Umm Al-Zein (2006). Kant heute: Oder der Mensch in den Grenzen der bloßen Vernunft. Beirut: Al-Dar Al-Thaqafi Al-Arabi [Arabisch]
- Hassner, Pierre (1987). Immanuel Kant; in: Leo Strauss und Joseph Cropsey (Hrsg.): History of Political Philosophy [Arabische Übersetzung: Mahmoud Sayyid Ahmad (2005). Kairo: Nationales Zentrum für Übersetzung.]
- Russ Jacqueline (1994). La Pensée éthique contemporaine. Paris: Presses Universitaires de France. [Arabische Übersetzung: Adil al-Awa (2002). Beirut: Awidat für Verlagswesen und Druck]
- Munsif, Abd al-Haqq (2009): Die Metaphysik des Rechts und die politische Begründung in der Moderne; in: Die kritische Grundlegung der Moderne: Eine Analse der Kantschen Philosophie. Rabat: Verlag der Fakultät für Geisteswissenschaften. [Arabisch]
- Musaddiq, Ismail (2009): Die historische Mission der kritischen Philosophie; in: Die kritische Grundlegung der Moderne: Eine Analse der Kantschen Philosophie. Rabat: Verlag der Fakultät für Geisteswissenschaften. [Arabisch]
- Kant, Immanuel (1790). Kritik der Urteilskraft. [Arabische Übersetzung: Said al-Ghanmi (2009). Beirut: al-Jumal]
- Russel, Bertrand. (1946). History Of Western Philosophy. Book Three: Modern Philosophy. George Allen and Unwin Ltd. [Arabische Übersetzung: Muhammad Fathi al-Shiniti (2011). Kairo: Ägyptische Behörde für das Buch]
- Gilje, Nils und Skirbekk, Gunnar (2001): A History of Western Thought. From Ancient Greece to the Twentieth Century. London: Imprint Routledge. [Arabische Übersetzung: Haydar Hajj Ismail (2012). Beirut: Arabische Organisation für Übersetzung.]
- Johnston, David (2011). A Brief History of Justice. Chichester:Wiley-Blackwell. [Arabische Übersetzung: Mustafa Nasser (2012). Kuwait: Nationaler Rat für Kultur, Kunst und Literatur]
- Kant, Immanuel (1793). Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. [Arabische Übersetzung: Fathi al-Maskini (2012). Beirut: Dar Jadawil.]
- Vincent, Andrew (1992). Modern Political Ideologies. Oxford: Blackwell. [Arabische Übersetzung: Khalil Kilaft (2017). Kairo: Nationales Zentrum für Übersetzung.]
Ali Abbood Al-Mohamedaoi
ist Professor für zeitgenössische und politische Philosophie an der Universität Bagdad, Irak. Er hat zahlreiche Werke veröffentlicht, die sich hauptsächlich mit Fragen der Moderne, Demokratie, der politischen Theorie, Revolution, Gewalt, intellektuellem Terrorismus und anderen Problemen der zeitgenössischen Philosophie befassen. Von 2015 bis 2016 war er Leiter des Fachbereichs Philosophie an der Universität Bagdad. Er ist Mitglied des philosophischen Beratungsgremiums des Hauses der Weisheit in Bagdad und Mitglied sowie Direktor der International Marlinskaya Academy in Moskau, Russland. Außerdem ist er Gutachter für verschiedene philosophische und wissenschaftliche Zeitschriften an mehreren arabischen Universitäten. Im Jahr 2014 erhielt er den Kreativitätspreis des irakischen Kulturministeriums und 2019 den Wissenschaftspreis des irakischen Ministeriums für Hochschulbildung.