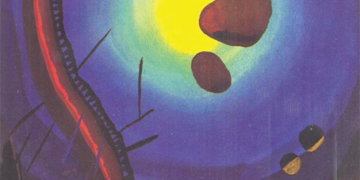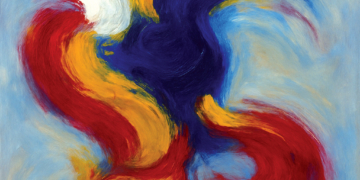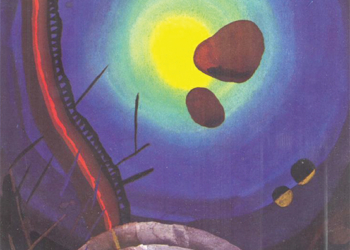Dieser Artikel widmet sich nicht der Analyse von Kants “Über Pädagogik” als solches, sondern um dessen Rezeption im zeitgenössischen arabischen Denken. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung können wir den Beginn der Auseinandersetzung mit diesem Werk von Kants kritischer Philosophie auf den Beginn des 20. Jahrhunderts datieren. An privaten und öffentlichen Bildungsinstitutionen, insbesondere natürlich an den philosophischen Fakultäten, wurde es unterrichtet und war gleichzeitig Gegenstand akademischen Interesses, von Übersetzungen aus dem Französischen, Englischen und Deutschen bis hin zu Überlegungen zur praktischen Umsetzung von Kants Vorstellungen. Seine Ideen wurden in Büchern, Zeitschriften und sogar Tageszeitungen diskutiert und waren Gegenstand intellektueller Debatten, die insbesondere von philosophischen Vereinigungen organisiert wurden.
Dieser Artikel fragt nach den praktischen Implikationen dieser Rezeption in Bezug auf zeitgenössische Fragestellungen wie das Verhältnis der Erziehung zu Disziplin und Freiheit, zu Zwang und Gehorsam, sowie das Verhältnis von moralischer, religiöser, sexueller und staatsbürgerlicher Erziehung – kurz: des Verhältnisses von Erziehung und Aufklärung.
Heute verstehen wir, dass beim Transport von Ideen zwischen Kulturen verschiedene Mechanismen wirken, die ihren jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, wie etwa der Kontext ihrer Produktion, die Umstände ihrer Rezeption und die rezipierende Person. Vor diesem Hintergrund verliert die Frage, inwieweit die „rezipierte Idee“ der „Ursprungsidee“ entspricht, ¬– oder das Konzept des „Beeinflussens und beeinflusst-Werdens“ der klassisch-historischen Methode –, ihre Sinnhaftigkeit.2
Kants Ideen wurden in Büchern, Zeitschriften und sogar Tageszeitungen diskutiert und waren Gegenstand intellektueller Debatten.
In der arabischen Welt können wir den Beginn der Beschäftigung mit Kants Philosophie auf die Eröffnung der philosophischen Fakultät in Ägypten Anfang des 20. Jahrhunderts datieren.3 Andere arabische Länder folgten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wobei hier große Unterschiede zu beobachten sind, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Erlangens der Unabhängigkeit, welche mit dem Aufbau nationaler Bildungssysteme einherging, im Rahmen derer auch Philosophie unterrichtet wurde. Die entsprechenden Länder versuchten, sich hierbei auf einige Grundwerte aus der Philosophie der Pädagogik zu stützen, sowohl in den Schulen als auch an den philosophischen Fakultäten selbst. In diesem Zusammenhang können wir beispielsweise auf den algerischen Lehrplan für Philosophie aus dem Jahr 1968 hinweisen, der auf Kants Moralphilosophie Bezug nahm.4
Erstreckte sich das Interesse zuerst primär auf Kants Moralphilosophie und Erkenntnistheorie, gerieten später auch seine Schriften zu Politik und Pädagogik in den Fokus, was sich sowohl in der akademischen Forschung als auch in der Publikation neuer Übersetzungen niederschlägt.5 Gab es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch relativ wenige Beiträge in diesem Feld, so nahm das Interesse insbesondere gegen Ende der zweiten Hälfte deutlich zu – eine Entwicklung, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Hier sind insbesondere Neuübersetzungen, die direkt vom deutschen Originaltext angefertigt wurden, zu nennen, so dass dem arabischen Leser heute eine beachtliche Anzahl von Kants Werken in seiner Muttersprache zur Verfügung steht.6 Ausgehend hiervon können wir untersuchen, wie Kants Ansichten zur Erziehung von der zeitgenössischen arabischen Philosophie aufgenommen wurden.
2. Der Stellenwert der Erziehung in der arabischen Rezeption von Kants Philosophie
Die arabische Rezeption von Kants „Über Pädagogik“ muss im Kontext der anderen ins Arabische übertragenen Werke analysiert werden.
Die arabische Rezeption von Kants „Über Pädagogik“ muss im Kontext der anderen ins Arabische übertragenen Werke analysiert werden. Die erste Übersetzung wurde in den 1930er Jahren von einem Professor der Ägyptischen Universität (heute: Universität Kairo) angefertigt, wobei er von einer englischen Übersetzung ausging und relativ frei mit dem Text umging.7 Ende der Sechziger folgte ein Kommentar8 und Ende der Siebziger Jahre dann eine detaillierte Erklärung.9 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden zwei Neuübersetzungen, die vom deutschen Originaltext ausgingen, veröffentlicht.10 Hierzu kamen ab 1979 Studien in arabischer Sprache, von denen sich manche auf eine Präsentation von Kants Ideen beschränkten, andere hingegen sich kritisch mit ihnen auseinandersetzten.11
Die Frage danach, wie Kants „Über Pädagogik“ in der arabischen Welt gelesen wurde, welche seiner Ideen die größte Aufmerksamkeit erhielten und welcher Bezug zur Aufklärung hergestellt wurde – also die Frage nach den „diskursiven Praktiken“, kann uns helfen, zu erfassen, wie diese Ideen das zeitgenössische arabische Denken beeinflusst haben. Was allerdings den Einfluss dieser Gedanken auf die Bildungsinstitutionen in den arabischen Ländern angeht, also die „nicht-diskursiven Praktiken“ , so müssten wir insbesondere die moralische Erziehung untersuchen und Feldstudien in verschiedenen arabischen Ländern durchführen. Schließlich ist eine sinnvolle Diskussion der kantischen Erziehungsvorstellungen und ihrer Rezeption innerhalb der kritischen kantischen Philosophie nur möglich, wenn wir den weiteren Kontext betrachten: Der lange und komplexe Prozess der Rezeption westlicher Ideen in der arabischen Philosophie seit Napoleons Ägyptenfeldzug im 18. Jahrhundert. Denn Erziehung ist kein rein theoretisches Thema, sondern reich an praktischen Bezügen, wobei der Aufbau moderner Bildungssysteme mit einem klar definierten moralischen und philosophischen Fundament sicher der relevanteste für die arabische Welt war.12
Die erste Übersetzung wurde in den 1930er Jahren von einem Professor der Ägyptischen Universität angefertigt.
Ausgehend hiervon können wir sagen, dass die kantische Moralphilosophie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Weg in das arabische Denken gefunden hat. Die 1947 von Muhammad Abdullah Draz an der Sorbonne Universität eingereichte und 1973 ins Arabische übersetzte Dissertation gilt als Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Neben seiner Analyse von Kants Philosophie widmete er sich insbesondere dem Verhältnis von Kants Moralphilosophie, insbesondere seines Pflichtbegriffs, zu dem, was er als die „ethische Verfassung im Koran“ bezeichnete. Trotz seines kritischen Ansatzes schreibt er: „[…] dass jemand seine Pflicht erfüllt, weil es eine Pflicht ist, ohne dabei dem moralisch Guten, das er anstrebt, Beachtung zu schenken, ist die Definition eines absolut aufrichtigen Willens. Wir werden zeigen, dass dies das Ideal der koranischen Ethik ist.“13 Allerdings ist diese moralische Dimension, insbesondere das Pflichtprinzip, sowohl im Ursprungstext von Kants „Über Pädagogik“ als auch in den arabischen Übersetzungen14 nicht zu übersehen, auch wenn diese teilweise verschiedene Terminologie verwenden.15
Kants „Über Pädagogik“ wurde in vielen arabischen Artikeln ausführlich analysiert […] Fathi Al-Shanitis begründet dies mit dem Stellenwert dieses Werks.
Kants „Über Pädagogik“ wurden in vielen arabischen Artikeln ausführlich analysiert, was Fathi Al-Shanitis mit dem Stellenwert dieses Werk begründet: Es sei „die Essenz seiner Erfahrung als Universitätsprofessor und Pädagoge, wobei er sich mit der Frage der Bildung im Kontext seiner Zeit genauso beschäftigte, wie mit Fragen der Erkenntnis, der Ethik und der Politik.“16 Zudem sei Kants Werk ist auf verschiedenen Ebenen kritisch: Er kritisiere Basedow und seine Arbeit am dessauischen Institut, das sich vor allem auf die Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten konzentrierte, wohingegen Kants Ansatz der geistigen, moralischen und praktischen Erziehung den Vorzug gab. Außerdem reflektiere Kant in diesem Werk über die Gesellschaft und ihren Fortschritt, über den Menschen und seine Entfaltung.
Verschiedene Philosophen haben versucht eine „Metaphysik der Erziehung“17 oder Leitlinien der kantischen Pädagogik herauszuarbeiten, wozu Disziplin und Arbeit oder Disziplin und Freiheit gehören, wobei sich diese Elemente je nach Analyse ergänzen oder auch widersprechen können. Laut Fathi Al-Shanitis zeige sich die Komplementarität dieser Elemente in der Persönlichkeit des „guten Staatsbürgers“ im Verhältnis zum Nationalstaat und des „schöpferischen Menschen“ im Verhältnis zur Menschheit insgesamt.18 Disziplin sei die erste Säule der Erziehung und erfordere Gehorsam, ob gewollt oder gezwungen, auf dass aus Schülern gute Bürger werden.19 Hier stellt sich die Frage, wie sich legitimer Zwang mit Freiheit vereinbaren lässt. Kant misst der Bestrafung nur wenig Wert bei, handele es sich doch nur um „einen oberflächlicher Anstrich der Persönlichkeit, der das eigentliche Ziel der Erziehung nicht erreicht“.20 Anstelle von Disziplinarmaßnahmen sollte laut Kant die Arbeit treten: „Der Mensch ist das einzige Thier, das arbeiten muß.“21 Er teilte also nicht die von Rousseau und Basedow vertretene Einstellung, dass der Mensch spielen müsse. Arbeit bedeute für ihn die Transformation von Stofflichem und die Erfüllung einer Funktion, und zwar deshalb, weil Arbeit „Subjektivität und Freiheit zugleich“ darstelle.22 In der Arbeit vereinten sich „Freiheit, Unterwerfung und Gehorsam zu einer synthetischen Einheit.“23 Diese Einsicht habe Kant lange vor Fichte, Hegel und Marx formuliert: „Wenn der Mensch die Welt verändert, verändert er sich selbst, und wenn er sich in die Welt investiert, investiert er in seine Energie und Fähigkeiten in gleichem Maße.“24 Arbeit ist also die Verbindung von Freiheit und Determiniertheit, von Gegenwart und Zukunft, die jede Bildung, die diesen Namen verdient, anstrebt. Dies formuliert Kant als zentrale These: „Kinder sollen nicht nur dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglichen bessern Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit und deren ganzer Bestimmung angemessen erzogen werden“.25
Die drei zentralen Fragen der kantischen Philosophie – Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? – sind mit der Frage „Was ist der Mensch?“ eng verknüpft. Da Menschenbild und Erziehungsideal eng miteinander verknüpft sind, ist diese Frage ist auch für Kants „Über Pädagogik“ zentral. Er kritisiert die traditionelle Pädagogik, die Verständnis und Vorstellungskraft zugunsten des Gedächtnisses opfert und argumentiert, das Auswendiglernen von Texten solle Kindern nicht aufgezwungen werden: „Das Memorieren ist sehr nötig, aber das zur bloßen Übung taugt gar nichts, z. E. daß man Reden auswendig lernen läßt.“26 Die Fokussierung auf das Auswendiglernen auf Kosten andere Fähigkeiten führe zu einem Ungleichgewicht, da es sich bei der reinen Wiedergabe um eine passive Aktivität handele: „Das Gedächtnis muß man frühe, aber auch nebenher sogleich den Verstand cultivieren.“27 Dieser Ratschlag wird in der arabischen Welt leider nur selten befolgt.
Die Wichtigkeit, die Kant der Arbeit bei der Erziehung zuschreibt, ergibt sich aus ihrem Zusammenhang zu Zwang und Disziplin. Dadurch, dass das Kind selbst aktiv wird, wandelt sich der äußere zu einem inneren Zwang; es gehorcht nicht mehr anderen, sondern sich selbst. Hier entdeckt es die Freiheit, die in der Unabhängigkeit des eigenen Willens besteht.
Moralische Erziehung zielt darauf ab, den Charakter zu formen, weshalb das Kind die Gründe für das von ihm erwartete Tun verstehen muss. Ziel ist also, dass das Kind nach Regeln handelt, deren Gerechtigkeit es selbst erkennt. Darum sollten Pädagoginnen und Pädagogen sich nicht von einer Logik von Belohnung und Bestrafung leiten lassen. Kant formuliert in diesem Kontext die Grundwerte seiner Pädagogik: Zum Erkennen der Gerechtigkeit der Gründe, auf denen die Regeln basieren, tritt die Wahrhaftigkeit, welche Kant aus der Bibel ableitet. Denn das Böse sei nicht durch Verbrechen, sondern durch Lügen in die Welt gekommen, weshalb Wahrhaftigkeit die wichtigste Charaktereigenschaft sei. Die beiden genannten Werte werden durch den Wert der „Geselligkeit“, also die Fähigkeit, sich in die Lage Anderer hineinzuversetzen, vervollständigt. Allerdings ist hierbei nicht Mitgefühl, sondern der Respekt der Rechte Anderer zentral. So prägen drei Tugenden den Charakter: Gehorsam, Wahrhaftigkeit und Geselligkeit. Indem wir die Würde des Kindes achten, schützen wir sein Selbstwertgefühl, was aber nicht mit einer übermäßigen Verwöhnung verwechselt werden sollte, wie dies in manchen arabischen Ländern der Fall ist.
Während Fathi Al-Shanitis einen metaphysischen Ansatz verfolgt, also allgemeine Prinzipien herauszuarbeiten versuchte, beschränken sich andere arabische Studien auf Analyse und Erklärung. Die wichtigste ist vielleicht die Arbeit von Abdel Rahman Badawi,28 der Kants Ansichten zur Bildung im Detail darlegt und sich dabei auf Übersetzungen von Texten aus dem Deutschen und Französischen stützt. In seiner Einführung erläutert er die historischen Hintergründe, also die in den Bildungsinstitutionen im Deutschland des 18. Jahrhundert vorherrschende Praxis, und arbeitet die Unterschiede zwischen Kants Pädagogik und der von Basedow und Rousseau heraus. Zudem geht er auf den Entstehungskontext von “Über Pädagogik” ein, das auf die Inhalte von Kants Pädagogikvorlesungen zurückgeht, die er über vier Semester an der Universität Königsberg hielt.29 Die Veröffentlichung des Buchs scheint eine Antwort auf die Kritik von Johann Gottfried Herder und Johann Georg Hamann zu sein und wurde von einem Schüler Kants, Friedrich Theodor Rink, ein Jahr vor seinem Tod im Jahr 1803 vorgenommen.30 Es war zudem geprägt durch die damals zirkulierenden Ideen, insbesondere das sogenannte Basedow-Pädagogikexperiment, welches Kant wie folgt beschreibt: „Die einzige Experimentalschule, die hier gewissermaßen den Anfang machte, die Bahn zu brechen, war das dessauische Institut. Man muß ihm diesen Ruhm lassen ungeachtet der vielen Fehler, die man ihm zum Vorwurfe machen könnte; Fehler, die sich bei allen Schlüssen, die man aus Versuchen macht, vorfinden, daß nämlich noch immer neue Versuche dazu gehören. Es war in gewisser Weise die einzige Schule, bei der die Lehrer die Freiheit hatten, nach eigenen Methoden und Planen zu arbeiten, und wo sie unter sich sowohl, als auch mit allen Gelehrten in Deutschland in Verbindung standen.“31
Abdel Rahman Badawi unternimmt einen ersten Versucht, die Ansichten Basedows und Kants zu vergleichen, und kommt zu dem Schluss: „Der wichtigste und gemeinsame Aspekt ist die moralische Erziehung“.
Abdel Rahman Badawi unternimmt einen ersten Versucht, die Ansichten Basedows und Kants zu vergleichen, und kommt zu dem Schluss: „Der wichtigste und gemeinsame Aspekt ist die moralische Erziehung“.32 Doch während Basadow der Religion den Vorrang einräumt, sieht Kant die moralische Pflicht als wichtiger an und gibt damit der moralischen Erziehung den Vorzug vor der religiösen Erziehung: „Die moralische Cultur muß sich gründen auf Maximen, nicht auf Disciplin. Diese verhindert die Unarten, jene bildet die Denkungsart. Man muß dahin sehen, daß das Kind sich gewöhne, nach Maximen und nicht nach gewissen Triebfedern zu handeln. Durch Disciplin bleibt nur eine Angewohnheit übrig, die doch auch mit den Jahren verlöscht. Nach Maximen soll das Kind handeln lernen, deren Billigkeit es selbst einsieht. Daß dies bei jungen Kindern schwer zu bewirken, und die moralische Bildung daher auch die meisten Einsichten von Seiten der Eltern und der Lehrer erfordere, sieht man leicht ein.“33
In seiner Haltung zu Disziplinarmaßnahmen ist Kant deutlich beeinflusst von Rousseaus „Keine Strafen mehr“. Wenn wir Kinder belohnen, so lernen sie, in guten Taten nur ein Mittel zu sehen. Sie tun also das Gute um der Belohnung willen, nicht um des Guten willen. Hieraus folgt, dass Strafe und Belohnung moralischer Natur sein müssen – im Falle einer Lüge etwa reicht ein verächtlicher Blick oder die Ablehnung eines Wunsches des Kindes –, denn im Leben besteht oft kein direkter Zusammenhang zwischen guter Tat und Belohnung oder böser Tat und Bestrafung.
Was Ali Watfas Studie auszeichnet, ist ihr kritischer Ansatz in der Untersuchung von Kants pädagogischer Ethik: „Um Kants Ideen zu verstehen, müssen wir die verschiedenen Dimensionen seiner Ethik der Erziehung umfassend analysieren und kritisch dekonstruieren.“ Diese Untersuchung beleuchtet nicht nur die verschieden Aspekte der kantischen Pädagogik sondern auch den intellektuellen Werdegang ihres Erdenkers und die Etappen seines philosophischen Schaffens. Sie geht auch auf das Menschenbild, das Kants pädagogischem Projekt zugrunde liegt, ein und behandelt den Stellenwert, den er der moralischen Erziehung einräumt. Zudem verortet sie seine Ideen in ihrem geschichtlichen Kontext, sowohl was die Erziehungspraxis zu seiner Zeit angeht, als auch in Bezug auf die Erziehungsvorstellungen zeitgenössischer Pädagogen. Zuletzt stellt sie auch eine Beziehung zwischen Erziehung einerseits und Aufklärung, Frieden und Sexualität andererseits her.
Kants Position, das Thema Sexualität in der Pädagogik nicht auszusparen, fasst Abdel Rahman Badawi wie folgt zusammen: „Schweigen gibt dem Bösen nur mehr Raum, das beweist die Erziehung, die frühere Generationen genossen haben. Heutzutage wird zu Recht anerkannt, dass man mit heranwachsenden Jungen über diese Themen ohne Ausflüchte und Umschweife klar und deutlich sprechen muss. Das ist offensichtlich ein heikler Punkt, denn nur wenige Menschen sprechen über dieses Thema gerne in der Öffentlichkeit. Aber dieses Problem lässt sich lösen, indem man es auf anständige und ernsthafte Weise bespricht.“34 Offensichtlich ist dieses Thema insbesondere in den arabischen Ländern ein heikles, weshalb Abdel Rahman Badawi Kants realistischen und vernünftigen Ansatz herausstellt: „Heranwachsende sollten nach und nach an die verschiedenen Aspekte dieser komplexen Problematik herangeführt werden, was weitgehend deckungsgleich mit der modernen Vorstellung ist, dass einer der größten Fehler, den Eltern und Lehrer begehen könnten, darin besteht, die Heranwachsenden nicht aufzuklären.“35
Die Studie zeichnet sich durch einen kritischen Umgang mit Kant aus und behandelt auch den Rassismus, der aus seinen Werken spricht: „Kant unterteilt die Menschen in Rassen und ordnet diese anhand ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit an: An oberster Stelle stehen Menschen mit weißer Hautfarbe; sie seien die intelligentesten und produktivsten und hätten Zivilisationen hervorgebracht. An zweiter Stelle folgen Menschen mit gelber Haut, dann Menschen mit schwarzer Haut und zuletzt die Indianer.“36 Dieser Rassismus zeige sich auch in Kants „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“, wo er schreibt: „Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Herr Hume fordert jedermann auf, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente gewiesen habe […] obgleich unter den Weißen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel empor schwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben.“37
Kant betont die Bedeutung der Arbeit in der Erziehung als Mittel, äußeren Zwang in innere Selbstbestimmung zu verwandeln. Ziel moralischer Erziehung ist es, dass Kinder Regeln aus Einsicht befolgen – nicht aus Belohnung oder Strafe. Kant nennt drei zentrale Tugenden: Gehorsam (durch Einsicht), Wahrhaftigkeit (als höchste Pflicht) und Geselligkeit (als Respekt vor anderen). Dabei warnt er vor übermäßiger Verwöhnung, wie sie in manchen arabischen Kulturen verbreitet ist.
Kants praktische Philosophie ist also von einer Dualität geprägt: „Im Licht stehen die weißen Menschen, deren naturgegebene Fähigkeit zum Fortschritt sie zum produktiven Teil der Menschheit macht. Im Dunklen stehen alle anderen Völker, von Natur aus entweder nutzlos oder nur Werkzeuge für das Wirken des weißen Mannes.“38 Auch in seinen Büchern „Physische Geographie“ und „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ gibt es Passagen, die diese Haltung bestätigen und seinem Konzept von Ethik, Universalität und Erziehung völlig widersprechen.39 Der Autor der Studie relativiert Kants Position jedoch und rechtfertigt sie durch den historischen Kontext: „Ohne die Bedeutung der rassistischen Position Kants herunterspielen zu wollen, müssen wir doch den historischen Kontext bei ihrer Bewertung berücksichtigen. Diese Kontextualisierung, der Verweis auf den in Europa verbreiteten Rassismus, ermöglicht es uns, den oben erwähnten Widerspruch zwischen Kants moralischen Höhenflügen und seinem Abstieg in die Niederungen des Rassismus zu erklären, und das Problem somit zu lösen oder zumindest in seiner Schwere zu mildern. So können wir Kants Moralphilosophie auf eine Weise lesen, die ihre Strahlkraft erhält.“40
3. Zwischen Erziehung und Aufklärung
In seinem Text „Was heißt: Sich im Denken orientiren?“ schreibt Kant: „Selbstdenken heißt den obersten Probirstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vernunft) suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung. Dazu gehört nun eben so viel nicht, als sich diejenigen einbilden, welche die Aufklärung in Kenntnisse setzen: da sie vielmehr ein negativer Grundsatz im Gebrauche seines Erkenntnißvermögens ist, und öfter der, so an Kenntnissen überaus reich ist, im Gebrauche derselben am wenigsten aufgeklärt ist. Sich seiner eigenen Vernunft bedienen, will nichts weiter sagen, als bei allem dem, was man annehmen soll, sich selbst fragen: ob man es wohl thunlich finde, den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grundsatze seines Vernunftgebrauchs zu machen. […] Aufklärung in einzelnen Subjecten durch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht; man muß nur früh anfangen, die jungen Köpfe zu dieser Reflexion zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber aufzuklären, ist sehr langwierig; denn es finden sich viel äußere Hindernisse, welche jene Erziehungsart theils verbieten, theils erschweren.“41
Ohne Zweifel wurde Kants Text „Was ist Aufklärung?“ in der arabischen Welt sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zwölf verschiedene Übersetzungen ins Arabische vorliegen. Dieses Interesse steigerte sich in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als Michel Foucault einen Kommentar zu Kants Text veröffentlichte, der mittlerweile in sieben arabischen Übersetzungen vorliegt.42 Ein weiteres Indiz für die Zentralität dieses Textes ist die Tatsache, dass die beiden arabischen Übersetzungen von „Über Pädagogik“ jeweils auch eine Übersetzung von „Was ist Aufklärung?“ beinhalten.
Für das arabische Denken wäre eine Wiederentdeckung von Kants Überlegungen zur moralischen Erziehung sicher ein Gewinn.
Viele Themen, die Kant in „Über Pädagogik“ behandelt sind bis heute relevant, wobei der Grad ihrer Bedeutung von Kontext zu Kontext unterschiedlich ist. In der arabischen Welt werden insbesondere seine Ideen zum Verhältnis der Erziehung zu Disziplin, Gehorsam und Zwang, seine Positionen zur Sexualaufklärung und die Frage nach dem Stellenwert von Religion und Moral in der Pädagogik breit diskutiert. „Für das arabische Denken wäre eine Wiederentdeckung von Kants Überlegungen zur moralischen Erziehung sicher ein Gewinn. Sie könnten ein Ausgangspunkt sein, um ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Moral in diesem Feld zu schaffen, neue Erziehungsvorstellungen hervorzubringen und den kritischen Geist in der arabischen Pädagogik zu schärfen, was für die Analyse des Ist-Zustandes des arabischen Erziehungswesens von großem Nutzen wäre.“43 Die arabische Rezeption von „Über Pädagogik“ belegt diese Aussage und zeigt zugleich einige Besonderheiten auf:
1) Arabische Vertreter des Existenzialismus und des Idealismus, etwa Zakaria Ibrahim, Abdel Rahman Badawi und Othman Amin, haben Pionierarbeit bei der Erforschung und Übersetzung Kants geleistet, auch wenn ihre Übersetzungen nicht vom deutschen Originaltext ausgingen oder diesen nur zusammenfassend wiedergaben. Ihr Hauptanliegen war, dem Vorurteil entgegenzutreten, Kants Philosophie sei zu komplex, um auf einfache oder vereinfachte Weise dargestellt zu werden. Zaki Naguib Mahmoud formuliert es in seinem 1936 veröffentlichten Buch „Geschichte der modernen Philosophie“ so: „Wer Kant lesen will, sollte auf keinen Fall Kant selbst lesen, denn Einfachheit und Klarheit waren nicht sein Ziel.“44 Dem entgegnet Zakaria Ibrahim: „Viele seiner Werke bestechen durch eine intellektuelle Klarheit, die wir bei kaum einem anderen Philosophen der Moderne finden.“45 Deshalb lädt er dazu ein, Kants Originaltexte zu lesen, „um die Systematik seines Denken zu verstehen“46 und die „lebendigen Aspekte des Denkens dieses intellektuellen Giganten“47 zu erfassen. Zudem sei es nötig, „Kants vor dem Hintergrund der modernen Philosophie seiner Zeit, auf die er aufbaute, zu lesen, um so seinen Beitrag, die kantisch-kopernikanische Wende, in der sich das gesamte Universum um den Menschen dreht, würdigen zu können.“48 Dieser akademische Ansatz wurde unter anderem auch von Othman Amin, Mahmoud Zidane und Abdel Rahman Badawi verfolgt.49
Kant plädiert für eine offene Sexualaufklärung statt Schweigen, das er als schädlich betrachtet. Abdel Rahman Badawi hebt diesen rationalen Ansatz hervor, der besonders im arabischen Kontext relevant ist, wo das Thema oft tabuisiert wird. Kant fordert eine direkte , altersgerechte Aufklärung – ein Konzept, das mit modernen pädagogischen Ansichten übereinstimmt.
2) Wir können den Beginn der Rezeption von Kant im modernen arabischen Denken auf die Zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts datieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Gründung von philosophischen Fakultäten in vielen arabischen Ländern sowie die Einführung von Philosophie als Unterrichtsfach in der Oberstufe zu einem verstärkten Interesse an Kants Philosophie, das sich gegen Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre noch einmal intensivierte, als das intellektuelle Leben die Fesseln einer ideologischen Dominanz abschüttelte. Im Rückblick können wir hier von einer Wiederbelebung der Auseinandersetzung mit Kant sprechen, sowohl in der Forschung als auch im Bereich der Übersetzung und der Anwendung. Besonders relevant waren hier Fragen der Ethik, der Freiheit, der Staatsbürgerschaft, der Universalität, der Kritik – also die Fragen der Aufklärung.
3) Die arabische Rezeption Kants war auch immer ein Ausdruck der philosophischen Bedürfnisse der jeweiligen Epoche. War das Interesse in den 1970er Jahren noch primär akademischer Natur und richtete sich auf Fragen der Erkenntnis und der Moral, so können wir seit den 1980er Jahren von einem politischen Interesse sprechen, welches mit dem Wunsch einherging, Kants Texte im Detail zu verstehen. Lange Zeit wurde Kant nur in einem postkantianischen Interpretationsrahmen gelesen, wobei Hegel eine besondere Rolle zukam. In der arabischen Welt wurde er zu den marxistischen Denkern gerechnet und galt somit als Repräsentant der von den 1950ern bis in die 1970er Jahre dominanten Ideologie. Dieser Rahmen weitete sich und gab der Philosophie des Neukantianismus – im weiten Sinne verstanden – Raum, wie er etwa von Ernst Cassirer, Jürgen Habermas, John Rawls und Michel Foucault vertreten wurde, nachdem vorher vom Strukturalismus ähnliche kritische Impulse für das zeitgenössische arabische Denken ausgegangen waren.
4) Zum großen Teil beschränkte sich die arabische Auseinandersetzung mit Kant auf eine unkritische Analyse seiner Gedanken sowie deren Aufbereitung und Präsentation. Eine Ausnahme stellt eine kritische Untersuchung von Kants Erziehungsvorstellungen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Entwicklungen in diesem Feld seit dem 18. Jahrhundert dar, die sich dabei auch auf die von westlichen Denkern formulierte Kritik, bei Kants Pflichtethik handele sich um moralischen Fundamentalismus, stützt. Dieser Kritikpunkt ist relevant, da die Pflichtethik das Fundament von Kants Vorstellung einer moralischen Erziehung darstellt. Diese Vorstellung widerspricht den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie: „In den ersten fünf Lebensjahren wirkt sich jede Form von Druck oder Zwang grundsätzlich negativ auf die Entwicklung des Kindes aus. Dies betrifft sowohl die Intelligenz, als auch die Formung der Persönlichkeit und die Zufriedenheit.“50 Insofern basiert moderne Erziehung auf „dem Respekt der Freiheit des Kindes, berücksichtigt dessen Neigungen und Wünsche und betrachtet dies als notwendige Voraussetzungen für die Entwicklung einer moralischen und kreativen Ausgeglichenheit.“51 Die fundamentalistischen Züge von Kants Erziehungsvorstellungen zeigen sich an seiner Bewertung des Spielens: „Scharfe Kritik und beißenden Spott übte er gegen Erzieher, die glaubten, man könne die Kinder durch das Spiel erziehen.“52 Allerdings ist der Einfluss von Kants Ideen auf zeitgenössische Erziehungsvorstellungen in der arabischen Welt wesentlich geringer als z.B. der von Jean-Jacques Rousseau, John Dewey oder Jean Piaget. Inwieweit sich diese Vorstellungen in der Praxis wiederfinden lassen, wäre ein lohnender Untersuchungsgegenstand für eine Feldstudie.
Die arabische Rezeption von Kants ,Über Pädagogik‘ muss im Kontext der Anderen ins Arabische übertragenen Werke analysiert werden.
5) Die Frage der Aufklärung ist ein gleichermaßen zentrales wie kontroverses Thema in der arabischen Kultur, bei dem sich mindestens drei Strömungen ausmachen lassen. Die traditionell-konservative Strömung, die salafistisch-religiöse Strömung, die Neues oder Modernes meist fundamental ablehnt, sowie die aufklärerische Strömung, die an struktureller Fragilität leidet. Letztere versucht, sich auf Kants kritische Philosophie zu stützen, sei es im kognitiven, politischen oder pädagogischen Bereich, um aktuelle Themen zu behandeln. In moralischen Fragen verweist diese Strömung auf Kants Pflichtethik, auf der sein Erziehungskonzept fußt. Diese moralischen Fragen sind für das arabische Denken heute zentral, da sie eine direkte Beziehung zur islamischen Religion haben. Der Versuch von Muhammad Abdullah Draz, Kants Pflichtethik mit den Moralvorstellungen des Korans in Einklang zu bringen, ist ein erster Schritt, der weitere Diskussion verdient, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Pflichtbegriff „der Dreh- und Angelpunkt des moralischen Systems ist.“53 Für ihn ist es wichtig, dass die Vernunft Quelle der Verpflichtung ist, sodass der Mensch zum Gesetzgeber wird. Unabhängig von der Bewertung dieses ersten Versuchs kann kein Zweifel daran bestehen, dass in dem gewählten Ansatz das Potential liegt, die kantische Philosophie in den Rang einer wirkmächtigen Strömung innerhalb der zeitgenössischen arabischen Philosophie zu erheben. Dies gilt insbesondere angesichts der neuen methodischen Werkzeuge, die der Neukantianismus uns zur Verfügung stellt.
Quellen:
1. Wir können den Beginn der arabischen Auseinandersetzung mit den Werken Kants auf die Veröffentlichung von Zakaria Ibrahims „Kant oder die kritische Philosophie“, Maktabat Misr, 1963, datieren. Die Auseinandersetzung mit der Kantrezeption (im Westen) durch die Übersetzung von entsprechenden Studien nahm ihren Anfang mit Othman Amins Übersetzung von Emile Boutreauds „Kants Philosophie“, al-Hai’a al-Misriya al-’Amma lil-Kitab, Kairo, Ägypten, 1972. Dem ging die Übersetzung einiger Originaltexte Kants voraus, etwa Abdel Ghaffar Mekkawis Übersetzung von „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, al-Dār al-Qawmīya li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-Našr, Kairo, Ägypten, 1965, Ahmed Al-Shaibanis Übersetzung von „Kritik der reinen Vernunft“, Dār al-Yaqẓa al-ʿArabīya li-t-Taʾlīf wa-t-Tarǧama wa-ṭ-Ṭabʿ, Beirut, Libanon, 1965, und Ahmed Al-Shaibanis Übersetzung von „Kritik der praktischen Vernunft“, Dār al-Yaqẓa al-ʿArabīya li-t-Taʾlīf wa-t-Tarǧama wa-ṭ-Ṭabʿ, Beirut, Libanon, 1966.
2. Siehe: Zur Rezeption der griechischen Philosophie in der islamischen Zivilisation: Die Position von Abdel Rahman Badawi (1917-2002), in: At-Tarǧama wa-ʾIškalāt al-Muṯāqafa, herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Abdul-Hakim Shubat, Forum für arabische und internationale Beziehungen, Doha, Katar, 2019, S. 675-703. Relevant in diesem Kontext ist auch Bourdieus Position, der Übermittlungsprozess von Ideen werde von „strukturellen Faktoren“ bestimmt, die diesen stören oder sogar verhindern könnten. Die wichtigsten Faktoren seien hierbei, dass Texte ohne Kontext übermittelt werden und übersetzte Texte einem Prozess direkter und indirekter Auswahl unterliegen. Siehe: Pierre Bourdieu, Les conditions sociales de la circulation internationale des idées, in: Actes de la recherches en sciences sociales, no145, 2002, S. 3-8.
Edward Said argumentiert in diesem Zusammenhang, es sei unmöglich, einen Text „neutral“ oder „unschuldig“ zu lesen, denn: „Every reader is to some extent the product of a theoretical standpoint, however implicit or unconscious such a standpoint may be. I am arguing, however, that we distinguish theory from critical consciousness by saying that the latter is […] a sort of measuring faculty for locating or situating theory. The critical consciousness is awareness of the differences between situations, awareness too of the fact that no system or theory exhausts the situation out of which it emerges or to which it is transported. Above all, critical consciousness is awareness of the resistances to theory, reactions to it […] or interpretations with which it is in conflict.“ Said beobachtet ein „wiederkehrendes Muster“ beim Übermittlungsprozess: „First, there is a point of origin, or what seems like one, a set of initial circumstances in which the idea came to birth or entered discourse. Second, there is a distance transferred, a passage through the pressure of various contexts as the idea moves from an earlier point to another time and place where it will come into a new prominence. Third, there is a set of conditions – call them conditions of acceptance or, as an inevitable part of acceptance, resistances – which then confronts the transplanted theory or idea, making possible its introduction or toleration, however alien it might appear to be. Fourth, the now full (or partly) accommodated (or incorporated) idea is to some extent transformed by its new uses, its new position in a new time and place.“ – Said, Edward: Traveling Theory. In: The World, the Text, and the Critic. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983. S. 226-47.
3. Anscheinend war der spanische Orientalist Conte de Glarza der erste Professor, der in den 1920er Jahren an der Ägyptischen Universität (heute: Universität Kairo) Vorlesungen über Kant gehalten hat. Siehe:
(1) Salah Hassan Rashid, „Lehre der Philosophie im ägyptischen Hochschulwesen“ [Arabisch: Tadrīs al-Falsafa fī Miṣr], in: „Stand der Lehre der Philosophie im ägyptischen Hochschulwesen“, Hrsg.: Afif Othman, Byblos, 2015, S. 485-522.
(2) Ahmed Abdel Halim Attia, Kant im zeitgenössischen arabischen Denken [Arabisch: Kānt fī l-fikr al-ʿarabī al-muʿāṣir], in: Kant und die Ontologie der Moderne, Dar Al-Farabi, Beirut, 2010, S. 17.
Da die letztgenannte Studie nur eine nicht-repräsentative Auswahl arabischer Werke zu Kant betrachtet, kann sie die Frage nach der arabischen Rezeption von Kants Philosophie sowie deren Anwendung nicht beantworten.
4. Siehe:
(1) Mahmoud Yaqoubi, Eine kurze Einführung in die Philosophie [Arabisch: al-waǧīz fī l-falsafa], Nationales Pädagogisches Institut [al-maʿhad at-tarbawī al-waṭanī], Algerien, 1968, S. 90–96.
(2) Al-Zawawi Baghoura: Der philosophische Diskurs in Algerien: Praktiken und Probleme. Eine erste Bestandsaufnahme [Arabisch: al-ḫiṭāb al-falsafi fī al-ǧazāʾir: al-mumārasāt wa-l-ʾiškalīyāt, tašḫīṣ ʾawwaliyy], in: Philosophie in der arabischen Welt im letzten Jahrhundert, im Rahmen des Zwölften Philosophischen Symposiums, organisiert von der Ägyptischen-Philosophischen Gesellschaft an der Universität Kairo, Zentrum für Studien zur arabischen Einheit, Beirut, Libanon, 2002, S. 377–409.
5. Beispiele hierfür sind unter Anderem:
(1) Abdelhak Monsef, Kant und die Herausforderungen des philosophischen Denkens: Von der Kritik der Philosophie zur Philosophie der Kritik [Arabisch: kānt wa-rahānāt al-tafakkur al-falsafī, min naqd al-falsafa ʾilā falsafa al-naqd], Casablanca, 2007.
(2) Abdelhak Monsef: Ethik und Politik, Kant im Angesicht der Moderne [Arabisch: kānt fī muwāǧahat al-ḥadāṯa], Casablanca, 2010.
(3) Gilles Deleuze: Kants kritische Philosophie. Ubersetzt von Osama Al-Hajj, University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, Beirut, Libanon, 2008.
(4) Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, übersetzt von Fathi Anqazou, Sofia Verlag, Kuwait, 2021.
(5) Artikel zu Geschichte und Politik, übersetzt von Tahya Anqazou, Arabisches Zentrum für Forschung und Politikstudien, Al Dhaayen, Katar, 2022.
(6) Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten, übersetzt von Fathi Anqazou, Sofia Verlag, Kuwait, 2023.
6. Auch wenn eine vollständige Übersicht aller auf Arabisch vorliegenden Publikationen von und über Kant im Rahmen dieses Artikels nicht möglich ist, sei doch eine Auswahl in chronologischer Reihenfolge aufgelistet:
1. Auf Arabisch verfasste Werke:
(1) Zakaria Ibrahim, Kant oder die kritische Philosophie [kānṭ ʾaw al-falsafa al-naqdīya], Misr Library, 1963.
(2) Zakaria Ibrahim, Das moralische Problem [al-muškila al-ḫuluqīya], Misr Library, 1966, Eine Theorie der Pflicht, 163-184.
(3) Mahmoud Zidan, Kant und seine theoretische Philosophie [kānṭ wa-falsafatuhu al-naẓarīya], Dar Al-Maaref, Kairo, Ägypten, 3. Auflage, 1979.
(4) Abdel Rahman Badawi: Kant [kānṭ]. Publications Agency, Kuwait, 1977.
7. Immanuel Kant, Die Erziehungsvorstellung des deutschen Gelehrten Kant [at-tarbiya li-l-ḥakīm al-almānī kānt], übersetzt von Tantawi Jawhari, Al-Salafiya Press, Kairo, Ägypten, 1936. (Dieser Text ist eine freie Übersetzung der englischen Übersetzung Siehe: Kant on Education (Heber Padagogik), übersetzt von Annette Churton, D.C. Heath & CO., Publishers, Boston, U.S.A, 1900.
8. Muhammad Fathi Al-Shenety: Kants Gedanken zur Erziehung [ḫawāṭir kānt fī t-tarbiya], in: Philosophische Studien. Eine Festschrift zu Ehren von Othman Amin mit einer Einführung von Ibrahim Madkour. Dar al-Thaqafa, Kairo, Ägypten, 1979, S. 275-290.
9. Abdel Rahman Badawi: Kants Philosophie der Religion und der Erziehung [falsafa ad-dīn wa-t-tarbiya ʿinda kānt], Arab Foundation for Studies and Publishing, Beirut, Libanon, 1980, S. 103–169.
10. Siehe:
(1) Immanuel Kant: Drei Texte: “Über Pädagogik”, “Was ist Aufklärung?” und “Was heißt: Sich im Denken orientiren?”. Übersetzt von Mahmoud Bin Jamaa, Muhammad Ali Publishing, Tunis, 2005.
(2) Immanuel Kant: “Über Pädagogik” und “Was ist Aufklärung?”. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Joseph Maalouf, Dar Al-Rafidain, Irak, 2022.
11. Weitere relevante Studien sind:
(1) Muhammad Al-Asma’i Mahrous, Einige pädagogische Aspekte im deutschen philosophischen Denken [baʿḍ al-ǧawānib at-tarbawiyya fī l-fikr al-falsafī al-ʾalmānī], in: Pädagogische Studien, Vol. 10, Bd. 77, 1995, S. 201-266.
(2) Khader Hamaidi und Asmaa Bin Al-Sheikh: Kant: Von der Erziehung zum Frieden [kānt min at-tarbiya ʾilā s-salām]; in: Ansana, Ausgabe 1, Juni 2010, S. 65-78.
(3) Saber Jiddouri: Der kantischer Idealismus und seine pädagogische Dimension (Eine Studie zur Philosophie der Erziehung) [al-miṯāliya al-kāntiyya wa-ʾabʿāduhā t-tarbawiyya (dirāsa fī falsafa at-tarbiya)], Zeitschrift der Universität Damaskus, Band 27, Ausgabe 1-2, 2011, S. 445-487.
(4) Muhammad Boumana, Der Stellenwert der Bildung in Kants Philosophie [makānat at-tarbiya fī falsafa kānt], in Bildung und Epistemologie, Band 1, Ausgabe 1, 2011, S. 6-30.
(5) Zuhair Al-Khuwaildi, Kants Theorie der Erziehung und die pädagogischen Grundlagen [an-naẓariyya at-tarbawiyya al-kāntiyya wa-t-taʾsīs al-bīdāġūǧī], in Al-Hewar Al-Mutamaddin, veröffentlicht am 17.9.2015.
(6) Malik Muhammad Al-Makanin, Anthropologie der Erziehung und Aufklärung in Kants Philosophie: Eine Studie über das Paradox des Urteilens über moralische Verantwortung [ʾanṯrūbūlūǧiyā t-tarbiya wa-t-tanwīr fī falsafa kānt: baḥṯ fī mufāriqat al-ḥukm li-l-masʾūliyya al-ʾaḫlāqiyya], in: Zeitschrift der ägyptischen philosophischen Gesellschaft, Jahrgang 28, Ausgabe 28, Seiten 313-343.
(7) Ali Yato, Erziehung im deutschen Idealismus von Kant bis Hegel [at-tarbiya fī l-miṯāliya al-ʾalmāniyya min kānt ʾilā hiġl], eine Sonderausgabe des Zentrums für Kritik und Aufklärung in den Geisteswissenschaften, Nr. 9416, April 2016. (45 Seiten).
(9) Nisreen Khalil Hussein, Die moralische Erziehung bei Immanuel Kant [at-tarbiya al-ʾaḫlāqiyya ʿinda ʾimānūʾīl kānt]; in: Iklil Magazine, Jahrgang 1, Ausgabe 4, Dezember 2020, S. 513-530.
(10) Ali Asaad Watfa: Die moralische Erziehung in der kantschen Philosophie Kritische, aktuelle Beiträge [at-tarbiya al-ʾaḫlāqiyya fī l-falsafa al-kāntiyya, mukāšafāt naqdiyya muʿāṣira]. Ausschuss für Übersetzung und Publikation,, Kuwait-Universität, Kuwait, 2022. (509 Seiten).
12. Siehe: Albert Hourani: Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939, übersetzt von Karim Azqoul. Dar Noufel, Beirut, Libanon, 2001, S. 60-61. Raif Khoury: Modernes arabisches Denken und der Einfluss der französischen Revolution in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht [al-fikr al-ʿarabī al-ḥadīṯ, ʾaṯar aṯ-ṯawra al-faransiyya fī tawǧīhihi as-siyāsī wa-l-iǧtimāʿī]. Dar Al Saqi, 3. Auflage, Beirut, Libanon, 2013, S. 64 ff.
13. Muhammad Abdullah Draz: La morale du Koran., übersetzt von Abd al-Sabur Shahin, Al-Risala Foundation und Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah, Kairo, Ägypten, 1973, S. 111.
14. Soweit uns bekannt ist, gibt es drei Übersetzungen des Buches „Über Pädagogik“:
(1)Die Erziehungsvorstellung des deutschen Gelehrten Kant [at-tarbiya li-l-ḥakīm al-almānī kānt], übersetzt von Tantawi Jawhari, Al-Salafiya Press, 1935.
(2) Drei Texte: “Über Pädagogik”, “Was ist Aufklärung?” und “Was heißt: Sich im Denken orientiren?”. Übersetzt von Mahmoud Bin Jamaa, Muhammad Ali Publishing, Tunis, 2005.
(3) “Über Pädagogik” und “Was ist Aufklärung?”. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Joseph Maalouf, Dar Al-Rafidain, Irak, 2022. Bei der ersten Publikation handelt es sich um eine freie Übersetzung aus dem Englischen, bei der zweiten und dritten um Übersetzungen aus dem Französischen, die auf der 1996 erschienen, französischen Fassung von Alexis Philonenko, einem Experten für Kants Philosophie, basierte. Hier zeigt sich, dass “Über Pädagogik” dem arabischen Leser erst mit großer Verzögerung zugänglich gemacht wurde, auch wenn andere Schriften Kants schon früher übersetzt wurden. Wir sehen auch, dass Kant seinen Weg in das arabische Denken zuerst nur über den Umweg französische und englisch Übersetzungen fand, direkt auf den Originaltext wurde meist erst später rekurriert.
15. Wir können eine deutliche Unterschiede zwischen den beiden Übersetzungen sowohl hinsichtlich der Gliederung als auch hinsichtlich des verwendeten Terminologie beobachten. Die erste verwendet zwei Hierarchieebenen und unterteilt die Erziehung zuerst in physische (ǧismiyya) und praktische (ʿamaliyya) Erziehung, um erstere dann noch in die Erziehung des Körpers (tarbiyat al-ǧism) sowie geistige (ʿaqliyya) und kulturelle (ṯaqāfiyya) Erziehung zu unterteilen. Die zweite Übersetzung unterteilt den Text in sechs Kapitel: 1. Über Erziehung (fī t-tarbiya), 2. Körperliche Erziehung (at-tanšiʾa al-ǧisdiyya), 3. Erziehung (at-tanšiʾa), 4. Geistige Erziehung (at-tanšiʾa al-fikriyya), 5. Moralische Erziehung (at-tanšiʾa al-ʾaḫlāqiyya), 6. Praktische Erziehung (at-tarbiya al-ʿamaliyya). Dieser Unterschied liegt in der Tatsache begründet, dass die erste Übersetzung strikt der französischen Übersetzung folgt, wohingegen die zweite sowohl Elemente dieser französischen Übersetzung als auch des deutschen Originaltexts enthält.
16. Muhammad Fathi Al-Shenety: Kants Gedanken zur Erziehung [ḫawāṭir kānt fī t-tarbiya]. S. 275. Hier bezeichnet der Autor seinen Ansatz als den Versuch, eine „Metaphysik der Erziehung“ herauszuarbeiten, wobei er sich auf Kants Verständnis von Metaphysik „als die rationalen Leitlinien einer Untersuchung, sowohl in Bereichen, in denen der menschliche Wille keine Rolle spielt, als auch bei geisteswissenschaftlichen Fragestellungen, die diesen Willen betreffen“ stützt.
17. Ibid., S. 786.
18. Ibid., S. 786.
19. Ibid., S. 786.
20. Ibid., S. 279.
21. Immanuel Kant: Über Pädagogik. AA, IX, S. 471.
22. Muhammad Fathi Al-Shenety: Kants Gedanken zur Erziehung. S. 280.
23. Ibid.
24. Ibid., S. 281.
25. Immanuel Kant: Über Pädagogik. AA, IX. S.447.
26. Ibid., S. 473.
27. Ibid., S. 474.
28. Abdel Rahman Badawi (1917-2002) hat mehrere Bücher über Kant veröffentlicht: “Immanuel Kant”, erschienen 1977, “Ethik nach Kant”, erschienen 1979 und “Philosophie des Rechts und der Politik”, erscheinen 1979. Alle Bücher wurden bei der Wakālat al-Maṭbūʿāt, Kuwait, veröffentlicht.
29. Abdel Rahman Badawi: Kants Philosophie der Religion und der Erziehung. S. 103.
30. Kants “Über Pädagogik” besteht aus drei Teilen: Einführung, Untersuchung und Schlussbemerkungen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Erziehungstheorie und diskutiert den Menschen als natürliches Geschöpf, frei in der physischen und praktischen Erziehung. Kant stützte sich hierbei auf Basedow, der in Dessau eine reformpädagogische Anstalt, das Philanthropinum, gegründet hatte, wo sowohl Lehrer ausgebildet als auch Schüler unterrichtet wurden. 1774 veröffentlichte Basedow sein “Elementarwerk” zur Pädagogik in vier Teilen samt eines bebilderten Anhangs, welcher Schülern als Verständnishilfe dienen könnte. Er rief dazu auf, einem “intuitiven” Ansatz zu folgen, der sich auf vier Säulen stützte: 1. Verwendung von Bildern in möglichst großem Umfang. 2. Der Gesundheit einen großen Stellenwert einräumen. 3. Den Religionsunterricht von jedem sektiererischen Aspekt befreien. 4. Möglichst wenig Auswendiglernen. (Abdel Rahman Badawi, S. 107) Eine weiteres wichtiges Element von Basedows Pädagogik war das Spielen. Das Philanthropinum bestand von 1793 bis 1774 und beeinflusste das europäische Pädagogik nachhaltig. Die Erziehungswissenschaft sieht in Basedows Erziehungstheorie drei Hauptprinzipien: 1. Der Vorrang des Nationalen vor dem Religiösen oder eine gewisse Unabhängigkeit von der Religion. 2. Eine pragmatische Einschätzung des Nutzens pädagogischen Wirkens 3. Der sinnliche, intuitive Ansatz.
31. Immanuel Kant: Über Pädagogik. AA, IX. S. 451.
32. Abdel Rahman Badawi: Kants Philosophie der Religion und der Erziehung. S. 10.
33. Immanuel Kant: Über Pädagogik. AA, IX. S. 480.
34. Abdel Rahman Badawi: Kants Philosophie der Religion und der Erziehung. S. 161.
35. Ali Asaad Watfa: Die moralische Erziehung in der kantischen Philosophie. S. 371.
36. Ibid., S. 411.
37. Immanuel Kant: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. AA, II, S. 235.
38. Lukas K. SOSOE : Kant and Africa: Two missed encounters? A Psychological Developmental Approach. Université du Luxembourg.
39. Beispiele für diese Aussagen sind: „Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ – Immanuel Kant: Physikalische Geographie, AA, IX, S. 316. „Die Schwarzen sind sehr eitel, aber auf Negerart und so plauderhaft, daß sie mit Prügeln müssen auseinander gejagt werden.” – Immanuel Kant: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. AA, II, S. 253.
40. Ali Asaad Watfa: Die moralische Erziehung in der kantischen Philosophie. S. 422. Verglichen mit anderen arabischen Untersuchungen von Kants Pädagogik zeichnet sich diese durch ihren kritischen Ansatz aus. Der Autor beschreibt seine Perspektive als soziologisch und spricht von Dekonstruktion, schenkt aber der gesellschaftlichen Realität – sei es das deutsche Bildungssystem zu Zeiten Kants oder arabische heutzutage – keinerlei Aufmerksamkeit. Insofern ist diese Untersuchung weitgehend theoretisch.
41. Immanuel Kant: Was heißt: Sich im Denken orientiren? AA, IIX, S. 146.
42. Kants Text „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ liegt auf Arabisch in zwölf Übersetzungen vor:
(1) Mustafa Fahmy: Mā t-tanwīr? Fī ṣafḥāt ḫālida min al-ʾadab al-ʾalmānī. Dar Sadr. 1970.
(2) Youssef Al-Siddiq: Mā huwa ʿaṣr al-tanwīr? In: Al-Karmel, eine vierteljährlich erscheinende Kulturzeitschrift, herausgegeben von der Al-Karmel Cultural Foundation, Ramallah, Palästina, Ausgabe 12, 1984.
(3) Abdul Ghaffar Makkawi: Al-ijābah ʿalā suʾāl mā al-tanwīr. In einer Gedenkschrift zu Ehren von Zaki Naguib Mahmoud, Kuwait-Universität, 1987.
(4) Othman Amin: Mā “al-tanwīr”? in: Pioneers of Idealism in Western Philosophy, Dar Al-Thaqafa, Kairo, Ägypten, 1989, S. 225-227. (Diese Übersetzung basiert auf nicht auf dem Originaltext sondern auf französischen und englischen Übersetzungen. Außerdem ist sie unvollständig, da sie nur die ersten fünf Absätze des Texts enthält.)
(5) Hussein Harb: Jawāb ʿan al-suʾāl mā hiya al-anwār In: Arab Thought Magazine, 1987.
(6) Ismail Al-Musaddiq: Ijābah ʿan al-suʾāl: Mā al-tanwīr. In: Fikr wa Naqd, Ausgabe 4, 1997.
(7) Mustafa Laarisa: Mā al-tanwīr. In:: Introductions, Maghreb Journal of Books, Marokko, Ausgabe 31, 2004.
(8) Muhammad Al-Hilali: Mā al-anwār? In: Modern Times, eine vierteljährlich erscheinende philosophische Zeitschrift. Ausgabe Nr. 1, April 2008.
(9) Fathi Anqazou: Jawāb ʿan suʾāl mā huwa al-tanwīr In: Artikel zu Geschichte und Politik, Arabisches Zentrum für Forschung und Politikstudien, Al Dhaayen, Katar, 2022, S. 121–128.
(10) Charbel Dagher: Kānt – fūkō, mā hiya al-anwār? Dar Al Anwar, 1999.
(11) Mahmoud Bin Jamaa: Thalāthatu nuṣūṣ: Ta’ammulāt fī al-tarbiyyah, mā hiya al-anwār? mā al-tawajjuh fī al-tafkīr? Muhammad Ali Publishing, Tunis, 2005.
(12) Joseph Maalouf: Fī al-tarbiyyah, wa ijābah ʿan suʾāl: mā al-tanwīr? Dar Al Rafidain, Irak, 2022.
Foucaults Text „Was ist Aufklärung?“ liegt auf Arabisch in sieben Übersetzungen vor:
(1) Hamid Tas: Mā hiya al-anwār? In: Fikr wa Naqd, Marokko, Ausgabe 5, 1997.
(2) Rashid Boutaib: Mā al-anwār? In: Bahrain Cultural Magazine, Bahrainisches Kultusministerium, Bahrain, Ausgabe 37, 2003.
(3) Mustafa Laarissa: Bayna kānt wa būdlīr: al-ḥadāthah kamawqif. In: Introductions, Maghreb Journal of Books, Marokko, Ausgabe 31, 2004.
(4) Zouaoui Beghoura: Al-tanwīr wa al-thawrah, fī mīshīl fūkō, mā al-tanwīr? Dar Afak, 2. Auflage, 2016, S. 74–103.
(5) Ahmed Al-Taribeq, Mā hiya al-anwār? Qirā’at mīshīl fūkō limaqāl kānt ḥawla al-anwār. in: Al-Hewar Al-Mutamaddin, Nr. 4752, 2015.
(6) Karim Jaaff: Mā al-tanwīr. In: Journal of Philosophy, 2019, S. 249–264. Und: Al-tanwīr, al-thawrah wa al-ḥadāthah, Shahryar Verlag, 2020.
(7)- Zuhair Al-Khalidi: Mā hiya al-anwār? Al-Hewar Al-Mutamaddin, Ausgabe 6696, 2020.
43. Ali Asaad Watfa: Die moralische Erziehung in der kantischen Philosophie. S. 12.
44. Zakaria Ibrahim: Kant oder die kritische Philosophie. Maktabat Misr. S. 11. Siehe auch: Zaki Naguib Mahmoud: Die Geschichte der modernen Philosophie [Arabisch: Qiṣṣat al-falsafah al-ḥadīthah], Verlag für Veröffentlichung und Übersetzung [maṭbaʿat lajnat al-ta’līf wa al-tarjamah wa al-nashr], Kairo, Ägypten, 1936, S. 249.
45. Zakaria Ibrahim, Kant oder die kritische Philosophie. S. 11.
46. Ibid., S. 12.
47. Ibid., S. 13.
48. Ibid., S. 8.
49. Othman Amin erreicht allerdings nicht das analytische Niveau der kritischen Arbeiten von Zakaria Ibrahim oder Abdel Rahman Badawi. Bei seinen Übersetzungen verfolgt er einen erklärenden Ansatz, bei dem er auf jeden übersetzen Absatz eine Erläuterung folgen lässt. Sein translatorisches Werk besteht aus: “Immanuel Kant”, veröffentlicht 1977, “Ethik nach Kant”, veröffentlicht 1979, “Philosophie des Rechts und der Politik”, veröffentlicht 1979, und “Religionsphilosophie und Pädagogik”, veröffentlicht 1980.
50. Ali Asaad Watfa: Die moralische Erziehung in der kantischen Philosophie. S. 454.
51. Ibid.
52. Ibid., S. 458.
53. Muhammad Abdullah Draz: Die ethische Verfassung im Koran [Arabisch: dustūr al-akhlaq fī al-qur’ān], Dar Al-Da’wa, Kairo, Ägypten, 1973, S. 8.
Zouaoui Beghoura
Algerischer Denker und Schriftsteller, Professor für zeitgenössische Philosophie und Dekan der philosophischen Fakultät der Universität Kuwait. Er forscht und publiziert in den Bereichen der Sozialphilosophie und politischen Philosophie und beschäftigte sich mit Fragen von Identität und Moderne, Sprache und Methodologie sowie Autorität und Freiheit. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Übersetzung aus dem Englischen und Französischen mit einem Fokus auf Werken der strukturalistischen Philosophie. Er hat mehr als zehn Übersetzungen veröffentlicht, insbesondere von Arbeiten von Michel Foucault.