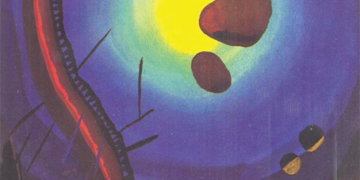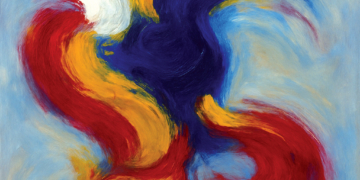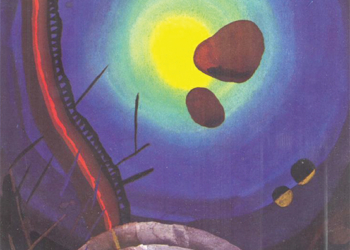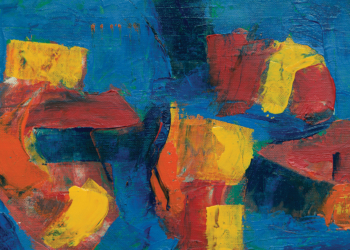Nach wie vor geht von der Kategorie des Weltbürgerrechts, die Immanuel Kant in zwei späten rechtsphilosophischen Texten eingeführt hat, große Anziehungskraft für die Politische Theorie aus.
Die nur wenige Seiten umfassenden Abschnitte des Ewigen Friedens (1795) und des Öffentlichen Rechts der Rechtslehre (1797), flankiert von kurzen Absätzen aus dem Privatrecht der Rechtslehre, gelten als Schlüsselelemente seiner Konzeption globaler Ordnung und dienen auch heutigen normativen Ansätzen zur bleibenden Orientierung (statt aller vgl. Habermas 2009, Benhabib 2008, Ypi 2014, Stilz 2016, Flikschuh 2017a). Den Adaptionen ist gemeinsam, dass sie Kants Weltbürgerrecht in Anspruch nehmen, um Kritik an Kolonialismus und europäischer Expansion zu üben und die Durchlässigkeit staatlicher Grenzen für Mobilitäts- und Kommunikationsrechte zu begründen. Das Weltbürgerrecht eignet sich vor allem deshalb zur aktuellen Inspiration, weil es alle Staatsmacht begrenzt, sich offenbar auf alle Individuen erstreckt, seine Träger1 gegenüber allen Staaten ermächtigt und so neben dem Staatsrecht und dem vertraglich fixierten, zwischenstaatlichen Völkerrecht den noch ausstehenden Schlussstein einer bleibenden Welt-Rechtsordnung bildet (Flikschuh & Ypi 2014, Huber 2022, Niesen 2021, Reinhardt 2019).
In den vergangenen dreißig Jahren hat sich allerdings parallel zu den Auslegungen, die konstruktiv an Kants Weltbürgerrecht anknüpfen, eine breite Diskussion seiner ‚rassen‘theoretischen Werke entzündet, die unser Verständnis des Weltbürgerrechts nicht unberührt lassen kann. Diese Literatur hat herausgearbeitet, dass Kant sich über weite Strecken seines Werks um eine biologische Begründung europäischer Überlegenheit bemüht und nicht-weiße Menschen als intellektuell, kulturell und moralisch unterlegen abqualifiziert. Über Jahrzehnte hat Kant in seiner Lehr- und Forschungstätigkeit in unterschiedlichen Disziplinen wie Anthropologie, Geographie, Geschichtsphilosophie und spekulativer Biologie rassistische Auffassungen propagiert, gegen Einwände verteidigt und in Vorlesungen an seine Hörer weitergegeben. Insofern er einen beträchtlichen Teil seiner intellektuellen Tätigkeit dem Thema der „Menschenracen“ widmete, kann dieses für sein Denken auch nicht als akzidentell oder randständig eingeschätzt werden (Rölli 2011). Mitnichten „unterliegt hier Kant den Vorurteilen seiner Zeit“ (Höffe 2020). Seine Positionen sind keineswegs durchgehend derivativ oder unkritisch von anderen Autoren übernommen, wenngleich mit unhaltbaren empirischen Annahmen wie der Phlogiston-Theorie belastet, was für ihre baldige wissenschaftliche Diskreditierung sorgte. Angesichts der unbestreitbaren Tatsache, dass rassistisches Gedankengut eine zentrale Rolle in der ideologischen Rechtfertigung der Unterwerfung und Kolonialisierung nicht-europäischer Völker spielte, muss nicht verwundern, dass die neuerliche Aufarbeitung von Kants Rassismus auch die Glaubwürdigkeit seines Anti-Kolonialismus und die Anwendbarkeit des Weltbürgerrechts auf globale Fragen von Nicht-Intervention, Mobilität und der Aufnahme schutzbedürftiger Menschen erschüttert hat.2
Das Ziel dieses Beitrags liegt nicht darin, die Belege für Kants Rassismus zu reproduzieren und im Detail zu erörtern. Die Primärliteratur ist mit unterschiedlicher Intention ausführlich ausgebreitet worden,3 und die Sekundärliteratur inzwischen in ein geradezu kanonisierendes Stadium eingetreten.4 Wenngleich sowohl zur dokumentarischen Qualität der Vorlesungsmitschriften und den unterschiedlichen Nuancierungen in verschiedenen Werkepochen Einiges zu sagen wäre, so sind doch auf der Grundlage der publizierten Schriften die Belege klar und unbestreitbar. Ebenso klar und unmissverständlich ist der Wortlaut der Passagen zum Weltbürgerrecht auf Hospitalität, so dass ein Interpretationskonflikt auf der Hand liegt. Wie lässt sich das Weltbürgerrecht vor dem Hintergrund von Kants eindrücklich nachgewiesenen rassistischen Theorieelementen verstehen? Diese Forschungsfrage soll in drei Hinsichten beantwortet werden. Zunächst stellt sich die Frage nach dem Skopus des Weltbürgerrechts. Wenngleich es offenbar universell formuliert ist, erstreckt es sich auf alle Menschen als Träger, oder nur auf Europäer? Und wenn ersteres, stellt sich sogleich die Frage nach seiner egalitären oder inegalitären Extension. Impliziert das Weltbürgerrecht universelle Rechtsgleichheit für alle Menschen, oder sind Abstufungen der Hospitalität zulässig? Schließlich stellt sich die Frage, ob der Inhalt des Weltbürgerrechts selbst durch Kants rassistische Begleitforschung kompromittiert ist. Anders gesagt: ist es möglich und sinnvoll, in heutigen Ansätzen an es anzuknüpfen? Dies schiene dann nicht mehr der Fall zu sein, wenn gezeigt werden könnte, dass die Kategorie des Weltbürgerrechts notwendigerweise diskriminierende Merkmale transportierte. Im Folgenden beantworte ich die drei Fragen mit ja, nein und „unter einer Bedingung“. Das Weltbürgerrecht ist Kant zufolge eine universalistische Mitgift aller Menschen, nicht nur der Europäer. Dass alle über das gleiche Weltbürgerrecht verfügen, bedeutet wiederum nicht bereits, dass seine Extension dagegen gefeit wäre, auf diskriminierende Weise bestimmt zu werden. Dort, wo dies möglich ist, resultiert es aus den Gründen, die Kants Anti-Kolonialismus motivieren und rechtfertigen. Die artikulierten Gründe, die Kant für das Weltbürgerrecht mobilisiert, sind normativ akzeptabel oder neutral. Es lässt sich aber nicht ausschließen, dass Kant auch auf verwerfliche Gründe zurückgreift, so dass es notwendig ist, das Weltbürgerrecht ausdrücklich von diesen odiosen möglichen Gründen zu trennen, um es für heutige Argumentationen anschlussfähig zu machen. Wo dies reflektiert wird, gehört das Kantische Weltbürgerrecht zu den universalistischen Innovationen, die es vermögen, ihre historischen Begrenzungen zu überwinden.
Mehr als eine kurze Rekapitulation des Weltbürgerrechts ist an dieser Stelle nicht notwendig, da es zur lingua franca der Internationalen Politischen Theorie gehört.5 Das Weltbürgerrecht ist „das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden“ (VIII: 358).6 Diese Ankunft kann willkürlich oder unwillkürlich erfolgen; sie dient dazu, den Versuch zu machen „sich zur Gesellschaft anzubieten“ (ebd.) und „sich zum Verkehr untereinander anzubieten“ (VI: 352). Der Versuch darf nur zurückgewiesen werden, wenn der „Untergang“ des Fremden nicht zu befürchten ist (VIII: 358). Kant führt die Kategorie erstmals in der Überschrift des Dritten Definitivartikels zum Ewigen Frieden ein, um das republikanische Verfassungsrecht und das vertragsförmige Völkerrecht um Rechtsansprüche für Individuen und nicht-staatliche Völker zu ergänzen. Seine zeitgenössischen Leser muss überrascht haben, dass er die Extension dieses neuartigen Rechts bereits im Augenblick seiner Formulierung wieder zurückzunehmen scheint: „‘Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.‘“ (VIII: 357) Damit ist von vornherein klar, dass es einen zugleich ermächtigenden und restriktiven Charakter aufweist. Das auf Hospitalität beschränkte Recht gibt den Konfrontationen zwischen Staaten und Fremden einen juridischen Status und soll drei ganz unterschiedliche Dinge leisten: den Schutz vulnerabler Personen vor Zurückweisung, wenn diese sie in Lebensgefahr bringen könnte; die Ermächtigung Fremder, sich zum Verkehr oder zur Gemeinschaft mit den Einheimischen anzubieten, sie zu besuchen und ihnen über Grenzen hinweg kommunikative Angebote zu machen; schließlich ein absolutes Verbot der Kolonialisierung nicht-europäischer Völker. Während der Ewige Frieden sich vornehmlich auf die Ansprüche von Individuen konzentriert, schreibt die Rechtslehre das Weltbürgerrecht nicht-staatlichen Kollektiven zu, ohne damit jedoch die individuelle Rechtsträgerschaft zu dementieren. Der Zusammenhang zwischen dem Besuchs- und Kommunikationsrecht und dem Anti-Kolonialismus liegt dabei darin, dass Kant die im frühmodernen Naturrecht (und auch in seinem eigenen Privatrecht) vorgesehene Kopplung zwischen Besuchs- und Aneignungsrecht unbesessenen Territorium dementiert. Im Gegensatz zur Dynamik der Staatsbildung, die durch Akte der prima occupatio ausgelöst wird, untersagt er jenseits staatlicher Grenzen die unilaterale Niederlassung. Keine Einigkeit besteht in der Literatur darin, ob er damit eine vorherige indigene Bemächtigung ratifiziert (Stilz 2014), den Verzicht der Ureinwohner auf unilaterale Aneignung schützt (Niesen 2007) oder schlicht deren ganz anders geartetes Besitz- und Eigentumsregime und damit ihre Nicht-Sesshaftigkeit respektiert (Flikschuh 2017b). In jeder dieser Lesarten dient das Weltbürgerrecht dazu, die gewaltsame Universalisierung einer europäischen Idee von Staatsbildung und Selbstregierung zu verhindern.
In der Literatur existieren im Wesentlichen zwei Strategien, Kants Rassismus mit dem Weltbürgerrecht in Beziehung zu setzen. Die erste lautet, dass der späte Kant Anti-Rassist und Anti-Kolonialist ist und sich von früheren problematischen Ansichten abwendet. Dies ist die Position von Pauline Kleingeld, die in ihrer begrifflichen Klarheit so etwas wie den „Goldstandard“ der Debatte darstellt (Zorn 2021) und die hier zunächst erörtert werden soll (1). Die zweite Lesart deutet Kants Denken ebenfalls als konsistent, nur dass für sie Kants Rassismus seinen Anti-Kolonialismus widerlegt oder entwertet. Dem anti-kolonialen Anti-Rassisten steht der rassistische Verteidiger kolonialer Denkweisen gegenüber. Die letztere Position soll im nachfolgenden Abschnitt erörtert werden (2). Meine eigene Lesart, der zufolge der späte Kant kein Anti-Rassist, gleichwohl ein anti-kolonialer Denker ist, wird im dritten Teil entwickelt (3). Meine These ist, dass Kants Anti-Kolonialismus kohärent ist mit seinen früheren Annahmen über die mangelnde Entwicklungsfähigkeit nicht-europäischer Völker, so dass sich seine Kolonialismuskritik einerseits aus guten rechtsphilosophischen und humanitären, andererseits auch aus schlechten, rassistischen Gründen ergibt.
1.
Kleingeld hält in aller Deutlichkeit fest, dass sie Kants langjährigen Rassismus seiner evaluativen Abwertung nicht-weißer Menschen und nicht bereits seiner Beweisführung entnimmt, es gebe genau vier Menschengruppen, die anhand erblicher Merkmale unterscheidbar seien (Kleingeld 2007). Huaping Lu-Adler hat in Anknüpfung an Anthony Appiah diese beiden Thesen in jüngerer Zeit zu einer Unterscheidung zwischen einem naturforschenden racialism und normativem racism präzisiert (Lu-Adler 2023: 79-84). Die beiden Theorieteile lassen sich auch unterschiedlichen Werken und Werkepochen zuordnen (Kleingeld 2014: 48f.; Eberl 2019). Die Unterscheidung zwischen racialism und Rassismus ist im Falle Kants allerdings nur analytisch zu verstehen. Kant vertritt beides, indem er eine rassistische These über die Fähigkeiten unterschiedlicher Menschengruppen aus seinem proto-biologischen racialism ableitet. Unter Kants Rassismus verstehe ich seine Behauptung einer Relation der Über- und Unterlegenheit zwischen Menschengruppen, die auf ungleichen, abstammungsbasierten charakterlichen und Vernunftfähigkeiten beruhe, die ihrer Entwicklungsfähigkeit unüberwindliche Hürden setzen und sich an der Hautfarbe ablesen lassen (vgl. Kleingeld 2007: 577-582). Von „racial hierarchy“ zu reden (Kleingeld 2007: 574ff.; Mills 2005: 173), erscheint mir dagegen irreführend, solange die Frage von Kolonialismus und Anti-Kolonialismus nicht geklärt ist, da Hierarchie eine Herrschaftsrelation ausdrückt oder zumindest nahelegt.
Zwar nimmt Kant einen gemeinsamen Ursprung der Menschheit an, aber es ist klar, dass der monogenetischen Sicht als solcher keine anti-rassistische Bedeutung beigelegt werden kann, steht doch im Zentrum seiner ‚Rassen‘lehre die Überzeugung, die Entwicklung unterschiedlicher Menschengruppe aktualisiere verschiedene „Keime“, die in ihnen gleichermaßen angelegt seien, auf unterschiedliche Weise und lege damit unwiderrufliche physiologische wie charakterliche Merkmale fest, die ihre Fähigkeit zur kulturellen Bildung und politischen Selbstherrschaft absolut determinieren und begrenzen. Sind die in allen Menschen vorhandenen ‚Keime‘ einmal durch den Einfluss klimatischer Faktoren ausgebildet und in die „Zeugungskraft“ eingegangen, sei auch durch die „Verpflanzung“ der gesamten Population in ein anderes Klima keine Veränderung mehr möglich (II: 442). Um dies begreiflich zu machen, muss Kant weitreichende empirische Behauptungen über Menschen aufstellen, die von einem Klima in ein anderes umgesiedelt werden, auf deren Beweiskraft er selbst immerhin wenig zu vertrauen scheint (VIII: 173). Die modale Formulierung des Unterschieds zwischen Menschengruppen, der zufolge es unmöglich sei, dass sich alle Menschen zum selben Zustand ‚empor arbeiten‘, wie Kant anderswo sagt, ist charakteristisch für die Verbindung seines Rassismus mit seinem naturforschenden racialism. Kant schreibt sich damit ein in eine lange Tradition des europäischen Denkens, die allein Europäern die vollständige Ausprägung der natürlichen menschlichen Anlagen, insbesondere ihrer mentalen und moralischen Fähigkeiten zutraut.7 Im Unterschied zu Aristoteles begnügt er sich jedoch nicht damit, eine binäre Unterscheidung zwischen Europäern und Nicht-Europäern zu treffen. Kant behauptet auch eine dogmatische Rangfolge der Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, die er mit Linné nach ‚weiß‘, ‚gelb‘, ‚schwarz‘ und ‚rot‘ einteilt. Die folgende, vielzitierte Passage stammt aus einer frühen, oftmals wiederholten und spät, doch zu Lebzeiten gedruckten Vorlesung zur Physischen Geographie. „Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften“ (IX: 316). Noch 1788 vertritt Kant die Idee einer Stratifizierung der Menschheit nach ihrer Hautfarbe, mit Afrikanern, die aufgrund ihrer klimatischen Adaption ein „träges“ Naturell ausgeprägt hätten, und den nur unzureichend klimatisch adaptierten indigenen Amerikanern (VIII: 176).
Für die folgende Argumentation ist entscheidend, dass dieser enge, biologistische Begriff des Rassismus verwendet und nicht mit modernen Verständnissen eines „kulturellen Rassismus“ (Fanon 2022: 46-48) überblendet wird, der ja den vorgeblichen Rückstand durch missionarische Expeditionen und die Einrichtung von ‚Erziehungsdiktaturen‘ aufzuholen suchen könnte.8 Nicht seine diskriminierenden Aussagen über den derzeitigen Entwicklungsstand von Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe definieren Kants Rassismus. Erst die These der physiologisch notwendigen Bedingtheit und Permanenz der Unterschiede ist das Kennzeichen von Kants Versuch, einen wissenschaftlich begründeten Rassismus zu verteidigen.
Kleingeld konzediert den Interpretationen von Eze (1994), Bernasconi (2001; 2002), Larrimore (1999) und Mills (2005), dass ihre Belege für Kants Rassismus über weite Strecken seiner Publikations- und Lehrtätigkeit überzeugend seien. Gleichwohl argumentiert sie, dass die Einführung des Weltbürgerrechts einen Lernfortschritt signalisiert, der aus Kants Auseinandersetzung mit den Idealen der Französischen Revolution entspringe und ihn seine Überzeugungen von weißer Überlegenheit aus den früheren Notizen, den Vorlesungen zur Physischen Geographie und Anthropologie und auch den Aufsätzen zu den „Menschenracen“ bis in die frühen 1790er Jahre hinein habe revidieren lassen.9 Diese These lässt sich werkgeschichtlich plausibilisieren. Allein Kants Schritt von der Unterstützung eines rechtsstaatlich eingehegten monarchischen Absolutismus noch im Jahr 1793 zur Propagierung der republikanischen Verfassung französischen Typs in den Jahren 1795 und 1797 deutet an, welche massiven Verschiebungen sich in Kants Denken während der produktivsten Phase seiner rechtsphilosophischen und politischen Publikationstätigkeit ereigneten, die ja erst zu Beginn der 1790er Jahre Fahrt aufnimmt. Wenngleich sich aber für eine konsolidierte anti-koloniale Position seit 1795 eindrucksvolle Belege finden, ist die Belegbasis für einen radikalen Sinneswandel im Hinblick auf die früher vertretenen rassistischen Einschätzungen seit 1795 zu dünn, um eine belastbare Schlussfolgerung nach der einen oder anderen Seite treffen zu können.10 Auf ein direktes Zeugnis lässt sie sich nicht zurückführen; es ist vielmehr unumstritten, dass sich Kant nicht ausdrücklich von seiner früheren Sicht distanziert hat und frühere Stellungnahmen unverändert oder erstmals drucken ließ. Wir müssen mithin der Möglichkeit ins Auge sehen, dass in seinem Denken eine rassistische Untergliederung der Menschheit und die Forderung ihrer universellen Ausstattung mit unverfügbaren Rechten koexistierten.
Wenngleich die Debatte über Kants späten Sinneswandel zwei scharf geschnittene Optionen präsentiert, so weist sie doch ein schwerwiegendes Defizit auf. Es liegt darin, dass sie sich ihre Kategorien und begrifflichen Alternativen bisher allein von der Moralphilosophie und nicht von der Rechtsphilosophie und Politischen Theorie vorgeben lässt. Dies zeigt sich bereits in dem Umstand, dass Kleingelds Leitfrage, die die Debatte bis heute prägt, nämlich ob Kant nun ein inkonsistent universalistischer oder ein konsistent inegalitärer Denker sei, sich auf seinen „moralischen Universalismus“ richtet:
“There is a genuine contradiction between, on the one hand, Kant’s stated universalist moral principles, which are formulated as applying equally to all humans (and even to all rational beings), and, on the other hand, his specific views on racial hierarchy and the various alleged deficiencies on the part of nonwhites” (Kleingeld 2007: 576, 584).11
Die Sichtweise, dass Kants Rassismus ein Konsistenzproblem für seine Moraltheorie aufwirft, wird von den Kritikerinnen geteilt. Auch in Beiträgen, die Kants Denken als unrettbar rassistisch interpretieren, wie in den einflussreichen Aufsätzen von Charles Mills, ist die Ausgangsfrage, wie sich die Annahme weißer Suprematie zum kategorischen Imperativ, also zur Moralphilosophie, verhalte: Handelt es sich um bei Nicht-Europäern um „Untermenschen“, wie Mills provokativ formuliert, die nicht der praktischen Vernunft teilhaftig sind und daher auch nicht unter ihrem universalistischen Schutz stehen (Mills 2005; 2018; zur Einordnung Huseyinzadegan 2022)?
Diese Frage muss hier nicht entschieden werden, denn im vorliegenden Zusammenhang geht es um rechtliche, nicht moralische Personalität. Es ist umstritten, inwiefern eine systematische Ableitungsbeziehung zwischen Kants Moralphilosophie und seiner Rechtsphilosophie besteht.12 Rechtsträger sind bei Kant unstrittig empirische Menschen, deren „Menschheit“ eine hinreichende Bedingung dafür ist, über „angeborene“ Rechtsansprüche zu verfügen (VI: 237). Menschheit kann hier vieles bedeuten, unter anderem, zu ein und derselben Spezies zu gehören (Niesen 2005: 52-60). Träger von Rechtsansprüchen sind nicht transzendentale Instanzen wie die Subjekte der Moral, sondern lebende Einzelwesen, insofern sie als willkürfrei angesehen und ihnen folglich Handlungen zugerechnet werden können (VI: 223). Insbesondere müsste erst gezeigt werden, dass das zentrale Merkmal für den moralischen Status von Menschen, die Fähigkeit der praktischen Vernunft, für sich selbst handlungswirksam zu sein, eine notwendige Bedingung für die Rechtsträgerschaft ist. Die Logik der Rechtslehre erfordert als hinreichende Bedingung dafür, über angeborene Rechte zu verfügen, dass man sich selbst Zwecke setzen kann (Ripstein 2009: 33). Die Fähigkeit, seinen Willen durch Vernunft zu binden und danach zu handeln, ist im Unterschied zur Orientierung am Rechtszwang keine, die man als kompetente Rechtsperson beherrschen muss, wie uns die Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität versichert (VI: 214). Doch selbst wenn man des Arguments halber voraussetzte, dass für die Teilhabe an natürlichen („angeborenen“) Rechtsansprüchen ein irgendwie qualifizierter moralischer Status, im Unterschied zu einem bloß rechtlichen notwendig sein sollte, so müsste dies das Weltbürgerrecht noch nicht tangieren, falls die Trägerschaft des Weltbürgerrechts nicht dem Einzelmenschen als Merkmal „angeboren“ und daher inhärent ist, sondern aus der Mitgliedschaft in einem Kollektiv (wiederum: der „Menschheit“, doch diesmal in anderer Bedeutung, als kollektiv-allgemeiner, nicht distributiv-allgemeiner Begriff verstanden) folgte. Die derzeit wohl avancierteste Interpretation etwa leitet das Weltbürgerrecht aus der gleichzeitigen Anwesenheit der Menschen als ausgedehnter Körper auf unterschiedlichen Flecken einer begrenzten Erdoberfläche her. Aus dem Umstand, dass Erdbewohner (earth dwellers) es nicht vermeiden können, einander physisch ins Gehege zu kommen, lässt sich ableiten, dass keine Person sich illegal dort aufhält, wo Geburt oder Zufall sie hingesetzt haben, und dass niemand ein ursprünglicheres Recht hat, sie von dort zu vertreiben oder sonst wie auf sie einzuwirken (Huber 2022). Diese relationale Lesart kann mit sparsamen begrifflichen Mitteln die negative Seite des Weltbürgerrechts – seine Kolonialismusabwehr – garantieren, ohne sich zum moralischen Status der so ermächtigten Wesen zu äußern.
Dass das Weltbürgerrecht allen Menschen zukommt, lässt sich daher nicht bereits dadurch unterminieren, dass die Unterstellung einer egalitären moralischen Subjektivität problematisiert wird. Allerdings ist damit noch nicht gezeigt, ob eine universelle Rechtsträgerschaft sich auch in einer umfassenden Ausstattung mit gleichen Rechten niederschlägt. Einschränkungen könnten in den Befugnissen des Weltbürgerrechts selbst oder seiner gesetzlichen Ausgestaltung liegen. Deshalb ist es wichtig zu betonen, dass das Weltbürgerrecht die genannten drei eng enumerierten Befugnisse für alle Menschen spezifiziert (Aufnahme, Kommunikationsrecht, Kolonialismusabwehr), aber nicht etwa pars pro toto für eine umfassend-egalitäre menschenrechtliche Ausstattung steht. Die bleibende Herausforderung des Weltbürgerrechts angesichts von Kants rassistischen Annahmen lässt sich in Anlehnung an seine Rede von bürgerlicher Selbständigkeit und bürgerlicher oder natürlicher Unselbständigkeit in seiner Konzeption der Staatsbürgerschaft verstehen. In seinen rechtsphilosophischen Schriften sieht Kant keinen Widerspruch darin, aufgrund von natürlichen oder sozialen Kriterien eine Abstufung zwischen Menschen in ihrer Ausstattung mit Rechten vorzunehmen.13 Beispielsweise schließt er Kinder und Frauen auf der Basis ihrer „natürlichen“ Konstitution vom Wahlrecht aus. Seine umstrittene Unterscheidung zwischen aktiven und (rechtlich geschützten, aber ihrer Teilnahmerechte beraubten) passiven Bürgern hält sich von 1793 bis 1797 unverändert durch (VIII: 295f.; VI: 314f.). Auch wenn im Ewigen Frieden und der Rechtslehre Hinweise auf eine differentielle Ausstattung mit den Befugnissen des Weltbürgerrechts fehlen und politische Autonomie im Weltbürgerrecht im Gegensatz zum Staatsbürgerrecht keine Rolle spielt (Williams 2007, Eberl/Niesen 2011, Kleingeld 2012),14 lässt sich doch nicht ausschließen, dass das Weltbürgerrecht für unterschiedliche Träger verschiedene Extensionen aufweisen könnte. Die Frage lässt sich mithin nicht abweisen, ob aus universeller weltbürgerrechtlicher Subjektivität unmittelbar eine rechtliche Gleichbehandlung in allen relevanten Hinsichten folgt, und soll im Abschnitt III. wieder aufgenommen werden.
Gleichwohl hat sich die Annahme zunächst als schlüssig erwiesen, dass Kants Verurteilung des Kolonialismus sich auf eine universelle Rechtsträgerschaft stützen kann, die entgegen Kleingelds und Mills‘ Annahmen durch moralphilosophische und moralpsychologische Vorgaben nicht determiniert ist. Was immer die von Kant unterstellten unterschiedlichen Vermögen für die moralische Subjektivität unterschiedlicher Menschengruppen implizieren mag, es vermag die Frage ihrer weltbürgerrechtlichen Subjektivität nicht zu unterminieren. Die Gegenüberstellung von inkonsistentem Universalismus und konsistentem Inegalitarismus in der Moral beantwortet die Fragen nach Skopus, Extension und Inhalt des Weltbürgerrechts nicht.
2.
Die zweite mögliche Interpretation lautet, dass Kant auch in seinem hier in Frage stehenden Spätwerk sowohl Rassist als auch Verteidiger kolonialen Denkens ist, und dass die Rhetorik des dort eingeführten Weltbürgerrechts diesen Umstand nur verschleiert. Diese für die rückblickende Bewertung der Philosophie der Aufklärung weit destruktivere Lesart findet sich bei J.K. Gani, Nikita Dhawan und, in einer Variante, bei Inés Valdez.
Gani stützt sich auf die Kategorie der „Kolonialität“, die die postkolonialen Autoren Aníbal Quijano und Walter Mignolo eingeführt haben, um zu argumentieren, dass Kant als ausdrücklicher Anti-Kolonialist dennoch als Wegbereiter des Kolonialismus verstanden werden müsse. Kolonialität versteht sie als übergreifende „Matrix“, die sich aus Kapitalismus, ‚Rassen‘hierarchien und rassistischen Epistemologien zusammensetze. Daher erscheint ihr Kants Rassismus geeignet, ihn trotz seiner offensichtlichen Zurückweisung des Kolonialismus als geistigen Parteigänger der Kolonialität identifizieren zu können. Auch dort, wo Kant der Kolonialisierung widerspricht, stehe sein Werk in der „Komplizenschaft in der Errichtung der Kolonialität“ (Gani 2017: 439).15 Gani schreckt davor zurück, Kant die ausdrückliche Exklusion von Nicht-Europäern aus dem Weltbürgerrecht vorzuwerfen. Andererseits fordere er aber auch nicht ausdrücklich ihre kategorische Inklusion, so dass die Frage ihrer Rechtsträgerschaft offenzubleiben scheint. Kants mangelnde Explizitheit erklärt sie sich damit, er habe sich die Inanspruchnahme des Weltbürgerrechts durch Nicht-Europäer nicht vorstellen mögen: „[H]e did not see the likelihood of large-scale non-European voyage, and thus saw no need to provide for it in his laws of hospitality“ (Gani 2017: 443f.). Der Vorwurf einer mangelnden Sensibilität für eine Migrationspolitik, die über den Schutz von Leib und Leben hinausgeht, richtet sich allerdings, wie Seyla Benhabib gezeigt hat, gegen Kants Weltbürgerrecht insgesamt. Sie sieht die Grenzen des kantischen Weltbürgerrechts gerade im unüberbrückbaren „Abgrund“ zwischen gefordertem Besuchs- und vorenthaltenem Niederlassungsrecht (Benhabib 2008: 47). Dass Kant nicht ausdrücklich ein weitreichendes Migrationsrecht für Nicht-Europäer gefordert hat, widerspricht also nicht den üblichen Interpretationen seines Weltbürgerrechts, denen zufolge er dies auch nicht für Europäer gefordert hat. In Abschnitt III. werde ich die Frage wieder aufnehmen, ob Kants Position ein differentielles Migrationsrecht für Europäer und Nicht-Europäer zuzulassen imstande ist.
In Antwort auf Gani ist zunächst zuzugestehen, dass das Ziel des vorliegenden Beitrags enger umschrieben ist, als es die Diskussion einer Gesamtkonstellation der Moderne namens „Kolonialität“ erforderte. Gleichwohl liegt auf der Hand, dass die Interpretation des Weltbürgerrechts kaum davon profitieren wird, wenn aus einem vorgängig als untrennbar unterstellten Zusammenhang von Rassismus, Kapitalismus und Imperialismus auch noch dem Weltbürgerrecht eine untergründige Kolonialität unterstellt wird, wenn dies nicht unabhängig zu belegen ist. Die Rede von einer „Matrix“ der Kolonialität, die Kant befördert habe, ist nicht informativ, wenn die Frage sich wie im vorliegenden Beitrag auf das Zusammenbestehen-Können von Rassismus und Antikolonialismus richtet. Dabei sei unbestritten, dass „Kants Schriften entscheidend an einem Diskurs mitwirkten, der gepaart mit kolonialer Macht weite Teile der Menschheit als Nicht-Subjekte oder Subjekte zweiter Klasse setzte“ (Biskamp 2017: 280). Aber daraus lässt sich nur ableiten, dass man auch als anti-kolonialer Denker als Verteidiger des Kolonialismus vereinnahmt werden kann, insofern es eine historische Verbindung von Rassismus und Kolonialismus gibt. Die Frage, was es vor dem Hintergrund eigener ‚rassen‘theoretischer Schriften Kants bedeutet, eine rechtstheoretische Kategorie allererst zu kreieren, die sich gegen den Skandal des Kolonialismus richtet, wird damit nicht einmal thematisiert. Vielmehr scheint Kants komplexe Position zu zeigen, dass es dem Ausdruck „Kolonialität“ genaugenommen um eine Kritik europäischer Überlegenheitsvorstellungen geht, die analytisch unabhängig von einer Positionierung zum Kolonialismus ist. Dagegen ist festzuhalten, dass „die europäischen Diskurse von Rassismus und Kolonialismus nicht konfundiert werden dürfen“ (Eberl 2019: 387). Die vom Weltbürgerrecht aufgeworfene Frage, ob es einen anti-kolonialen Rassismus und womöglich auch ebenso einen kolonialismusfreundlichen Anti-Rassismus geben kann, würde damit umgangen.
Auch Nikita Dhawan versucht, das Weltbürgerrecht auf indirektem Wege als inhärent kolonialismusfreundlich nachzuweisen. Sie verwirft ebenfalls die Interpretation, das Weltbürgerrecht komme nicht allen Menschen zu und hält zu Recht fest: „Recognizing blacks as human and granting them legal status so that they are protected by cosmopolitan right did not mean that Kant considered them equal to white Europeans”(Dhawan 2017: 494). Dieser Ausgangspunkt ist, wie wir gesehen haben, analytisch valide und werkbiographisch plausibel. Hinter die eigene Differenzierung fällt Dhawan allerdings zurück, wenn sie als Ergebnis ihres Beitrags festhält: „[T]his article debunks the claim that Kantian cosmopolitanism was an antidote to colonialism“ und von einer bloß „rhetorischen Gegnerschaft zum Kolonialismus“ spricht (ebd.: 488, 495). Aus dem Umstand, dass Kant ein Revolutionsverbot formuliert, folgert sie, dass er damit zugleich ein antikoloniales Befreiungsverbot fordere. Zudem spreche sich Kants Völkerrecht dagegen aus, dass gewaltsam angeeignetes Territorium rückerstattet und historisches Unrecht wieder gutgemacht werde (ebd.: 495). Diese Argumente erscheinen aber nicht zwingend, weil sie Staatsrecht, Völkerrecht und Weltbürgerrecht überblenden.16 Aus dem Umstand, dass Kant ein Revolutionsrecht ablehnt, auch wenn der Herrscher die Prinzipien des Staatsrechts verletzt, lässt sich auch nicht folgern, wie dies Dhawan und Kleingeld (2014: 61) übereinstimmend tun, dass er ein koloniales Befreiungsrecht, das auf eine Verletzung des Weltbürgerrechts folgt, ablehnte. Aus den völkerrechtlichen Überlegungen über Krieg und die Folgen historischen Unrechts lässt sich nicht auf eine Friedenspflicht oder ein Kriegsrecht und auch nicht auf einen bestimmten Umgang im Hospitalitätsrecht schließen, denn es handelt sich bei ihm um eine selbständige Kategorie des öffentlichen Rechts. Im Gegenteil, aufgrund seiner vergleichsweise deutlichen inhaltlichen Bestimmtheit bereits im globalen Naturzustand lässt sich behaupten, dass das präzise Weltbürgerrecht geeignet ist, das weitgehend unbestimmte Völkernaturrecht in seine Schranken zu weisen. Das lässt sich daran zeigen, dass im Naturzustand unter Staaten ein ius ad bellum geltend gemacht werden kann, wenn ein Land sich bedroht oder geschädigt fühlt (VI: 346), während das Weltbürgerrecht die Berufung auf ein solches Recht gerade ausschließt. Vielmehr wird das Weltbürgerrecht eingeführt, wie Christopher Meckstroth (2018) in seiner minimalistischen Interpretation gezeigt hat, um anlandenden Europäern das traditionale ius ad bellum gerade vorzuenthalten, über das sie über Jahrhunderte hinweg naturrechtlich verfügen zu können glaubten. Dhawans Interpretation lässt diese Differenzierungen vermissen, indem sie sich wie Gani im Hinblick auf Kant in einem unauflöslichen Begriffskorsett von rassistischem Kolonialismus und kolonialem Rassismus bewegt. Damit wird Kant eine konsistente Position beigelegt, die jede eigenständige Bedeutung des Weltbürgerrechts mystifizieren muss.
Inés Valdez trägt eine subtile Variante postkolonialer Kritik vor. Sie gesteht Kant zähneknirschend eine anti-koloniale Position zu, in der sie allerdings die bleibende Präsenz seines Rassismus am Werk sieht. Kant erkenne zwar nicht-europäische Völker als gleichberechtigte Vertragsparteien an, die nicht übervorteilt werden dürften (Valdez 2017: 831; vgl. VI: 266). Er wende sich damit aber nur gegen die (betrügerischen, grausamen) Mittel der Kolonialisierung, nicht deren Ziele – andernfalls geriete er in Widerspruch zu seiner präskriptiven Fortschrittstheorie:
“This is not to say that the protection of natives is indirect but to say that these condemnations are compatible with civilizational hierarchy, that is, Kant’s belief that populating these countries with civilized peoples would potentially be more conducive to progress, even if he knows that, in the particular juncture when he is writing, this cannot happen without violence, and is thus impermissible” (ebd.: 831).
In anderen Worten, wären die Methoden der gewaltsamen Zivilisierung des Erdkreises nicht inakzeptabel, müsste Kant sich für die Kolonialisierung aufgrund ihres „guten Zwecks“ aussprechen – dies wirke sich, ähnlich wie bei seiner klammheimlichen Affirmation der an sich verbotenen Französischen Revolution, auf die evaluative Beurteilung der verbotenen Tat aus (ebd.). Während Valdez ihre Deutung auf Siedlungskolonien bezieht, hat Thomas McCarthy dasselbe Argument für Beherrschungskolonien formuliert. Kants Kolonialisierungsverbot stehe der europäischen Expansion entgegen, auch wenn er sie kraft ihrer Fähigkeit zur „Ausbreitung von Kultur und Zivilisation, Recht und Religion Europas über die übrige Welt als geeignetes Vehikel ansieht“, um der Menschheit als Ganzer zu zivilisatorischem Fortschritt zu verhelfen (McCarthy 2015: 107ff.). Valdez und McCarthy machen zu Recht darauf aufmerksam, wie eng Kants physiologische Studien mit seiner teleologischen Geschichtsauffassung verknüpft sind, der zufolge die Menschheit ihre Vollendung nur in einer globalen Rechtsordnung anstreben kann (VIII: 24-28; VIII: 349). Sie erklären aber nicht den Umstand, dass Kant für den Fall der angeblich kolonial angestrebten Beförderung von Staatlichkeit oder Kultur kein „Erlaubnisgesetz“ vorsieht. Mit dieser Kategorie löst er andernorts das Problem, dass am Anfang der Errichtung rechtlicher Verhältnisse – Kant zufolge unvermeidlicherweise – unilaterale Bemächtigung und Gewalt stehen (VIII: 347; VI: 247; Brandt 1982). Im Fall kolonialer Eroberung kann jedoch selbst die „Absicht diese [rechtlichen Verhältnisse] zu stiften und diese Menschen (Wilde) in einen rechtlichen Zustand zu versetzen“ den „Schleier der Ungerechtigkeit“, in den sich solche Rechtfertigungen hüllen, nicht ungeschehen machen (VI: 266).
Valdez formuliert im Wesentlichen drei Argumente, die zusammengenommen das Weltbürgerrecht relativieren sollen. Das erste lautet, dass Kant den Kolonialismus im Kern deshalb ablehnte, weil er Konflikt und Krieg in die Beziehungen der europäischen Staaten zueinander hineinträgt. Dieses Argument belegt sie schlüssig an Kants Texten und den historischen Begleitumständen,17 nur stellt sie Kant damit den Heroen des europäischen Antikolonialismus von Diderot über Smith bis Bentham an die Seite, die alle in Personalunion eine Mischung aus humanitären, ökonomischen und pazifistischen Gründen vortrugen (Pitts 2006). Es fragt sich daher, was es für die Interpretation von Kants Anti-Kolonialismus besagen kann, weil das eurozentrische Friedensinteresse offenbar mit seinen humanitären und naturrechtlichen Überlegungen verträglich ist. Es lässt sich aber aus der Verwendung eines selbstinteressierten, noch dazu eines Anti-Kriegs-Arguments nicht schließen, dass andere normative Argumente damit inkompatibel sind oder als bloße flankierende Schutzbehauptungen vorgetragen werden. Der Lackmustest für das Argument läge darin, ob Kant das Weltbürgerrecht auch für den hypothetischen Fall forderte, dass Kolonialismus zur Sache eines einzigen globalen Imperiums würde, wie sich das beispielsweise Bentham für eine globale britische Vorherrschaft vorgestellt hat (Niesen 2007). Die Plausibilität des Besuchs- und Schutzrechts ebenso wie des Interventionsverbots und globalen Kommunikationsrechts hängt aber nicht von der An- oder Abwesenheit imperialer Auseinandersetzungen ab. Valdez‘ erstes Argument hat daher keine Beweiskraft, weil das europäische Eigeninteresse an der Vermeidung von Kolonialkriegen mit den von Kant vorgetragenen normativen Argumenten keineswegs unverträglich erscheint. Ihr zweites Argument lautet, dass Kant den Kolonialismus auf eine Weise ablehnt, die die nichteuropäischen Völker diskriminiert. Kant erörtere in seinem Völkerrecht nur die Beziehungen zwischen europäischen Staaten – den nicht-europäischen Staaten verweigere er, indem er sie ausnahmslos wie nicht-staatliche Völker im Weltbürgerrecht abhandelt, die völkerrechtliche Anerkennung. Sie beruft sich darauf, dass Kant im Dritten Definitivartikel von den Verbrechen der Briten an den indischen „Staaten“ spricht und diese ebenso wie Japans und Chinas Isolationismus im Weltbürgerrecht abhandelt (Valdez 2017: 824). Kant hatte tatsächlich gegenüber dem traditionellen ius gentium den Geltungsbereich des Völkerrechts als den eines zwischenstaatlichen Rechts präzisiert, das nicht auf Konflikte mit nicht-staatlichen Völkern anwendbar ist. Die nicht-europäischen Völker werden aber durch Kolonialisierung auch dort verletzt, wo ihre Staatlichkeit von den europäischen Mächten, die so tun, als ob es sich wie im Fall der indischen Fürstentümer nicht um bereits bestehende Staaten handelt, nicht anerkannt wird. Kolonialisierung ist ein konkretes Unrecht zwischen Völkern, das aus der Annexionsabsicht eine Interventions- und Besatzungsbefugnis ableitet und nicht aus der vorgängigen oder befürchteten Schädigung wie beim Staatenkrieg (VI: 346). Ebenso wird man den möglichen Konflikt zwischen China und Japan, die ihre Grenzen gegenüber europäischen Emissären schützen, und europäischen Staaten, den Kant Valdez zufolge zu Unrecht im Weltbürgerrecht statt im Völkerrecht abhandelt, als weltbürgerrechtlichen, als Streit um die Extension der Hospitalität einschätzen müssen, der unabhängig vom staatlichen oder nicht-staatlichen Charakter der beteiligten Völker ist. Valdez unterliegt hier dem spiegelverkehrten Irrtum zu Dhawan, die aus Kants Völkerrecht Rückschlüsse auf Recht oder Unrecht der Kolonialisierung zieht. Während Dhawan darauf besteht, Rechtsfolgen der naturrechtswidrigen Kolonialisierung spekulativ aus dem Völkerrecht abzuleiten, besteht Valdez aus Gründen der Gleichbehandlung darauf, Konflikte um Kolonialisierung, die systematisch zum Weltbürgerrecht gehören, im Völkerrecht abzuhandeln.
Valdez‘ drittes Argument klingt auch bei Mills, Kleingeld, McCarthy und Dhawan an, und im Unterschied zu den beiden vorhergehenden bringt es uns der Antwort auf die Ausgangsfrage näher. Die eigentliche Herausforderung des Weltbürgerrechts, nämlich ob Kants Anti-Kolonialismus mit seinem Rassismus koexistieren kann, entscheidet sich daran, ob Kant den Kolonialismus aus rassistischen Gründen ablehnt. Wenn dies zutrifft, müsste es die Bedeutung und wohl auch die Extension des Weltbürgerrechts empfindlich beeinflussen. Wenn Kant etwa glaubte, dass Europäer sich nicht in entfernte Weltgegenden bewegen sollen, damit keine Aussicht auf Mischehen bestehe (McCarthy 2015: 91; Dhawan 2017: 494; Valdez 2017: 832), wären wir gezwungen, Zweifel an der universalistischen Oberflächenbedeutung seines Besuchsrechts anzumelden. Nebenbei bemerkt: ein solches Argument verträgt sich schlecht mit der Lesart, Kants Anti-Kolonialismus sei bloß „rhetorisch“. Wenn sich Kant aufgrund von weißen Reinheitsvorstellungen gegen die Kolonialisierung nicht-europäischer Völker wendete, wäre sein Anti-Kolonialismus genuin, wenngleich odios.
Kant spricht sich im Zusammenhang seiner naturforschenden Erklärungsversuche, warum es mehrere ‚Rassen‘ gibt, gegen deren „Vermischung“, die ihre klimatische Adaptionsfähigkeit rückgängig machen könnte, und gelegentlich auch gegen Mischehen aus, wobei die letzteren Textbelege früher, rhapsodischer und insgesamt weniger belastbar sind. In Reflexionen zur Anthropologie wird den Spaniern in Mexiko davon abgeraten wird, sich mit den ursprünglichen Einwohnern zu „vermischen“ (XV: 878); gleichzeitig ist diesen Notizen zufolge von Kindern aus Mischehen wenig zu erwarten (XV: 598), das heißt sie werden nicht notwendigerweise die jeweiligen Spezialisierungen in der Adaption beibehalten und die unterstellten Beschränkungen in der Entwicklung überwinden. Valdez zieht eine späte publizierte Textstelle gegen „Vermischung“ heran, versäumt aber mitzuteilen, dass ihr Zitat nicht aus der Diskussion von „Menschenracen“, sondern von europäischen Nationalcharakteren stammt, die Kant zufolge auf ein und dieselbe biologische Ausstattung zurückgehen und dennoch unterschiedliche charakterliche Ausprägungen haben (Valdez 2017: 832; vgl. VII: 320). Das Zitat überführt ihn der Borniertheit und nicht der Motivation des Rassismus.18 Dennoch lässt sich der Frage nicht ausweichen, ob das Ziel einer Vermeidung von Mischehen einen rassistischen Anti-Kolonialismus motivieren könnte.
Dies scheint mir insgesamt ungereimt, weil das Weltbürgerrecht gerade eingeführt wird, um die Bedingungen der Hospitalität zu klären und ein universelles Besuchsrecht einzurichten. Hospitalität bedeutet das „Recht des Erdbürgers …, die Gemeinschaft mit allen zu versuchen und zu diesem Zweck alle Gegenden der Erde zu besuchen“ (VI: 352). Das heißt, dass niemand ein Unrecht angetan wird, wenn privatrechtliche Angebote wie etwa Heiratswünsche über Grenzen hinweg geäußert werden. Das Weltbürgerrecht illegalisierte also ein generelles Verbot der Eheanbahnung unter Fremden, wenngleich nicht deren Regulierung.19 In den Notizen zum Ewigen Frieden hebt Kant hervor, dass mit Besuchen auch die Aufnahme unter demselben Dach verbunden ist, und dass mit dem Schiff und dem Kamel kulturinvariante Mittel zur Überbrückung von Distanzen zwischen Völkern zur Verfügung stehen (XXIII: 173). Kants oftmals geäußerte Auffassung, dass die Naturnotwendigkeit eine vollständige Besiedlung der Erdoberfläche erfordere (vgl. VIII: 364f.), und dass diese wegen der unterschiedlichen klimatischen Anforderungen nur auf der Basis der jeweils speziell adaptierten ‚Keime‘ möglich ist, bedeutet, dass die völlige Aufhebung der Unterschiede (die er ohnehin aus Gründen der Neigung und Abneigung nicht erwartet) kontraproduktiv, nicht aber die Zunahme von Mischehen als solche einer ‚Naturabsicht‘ zuwider wäre. Die Logik des Weltbürgerrechts ist es gerade, die globale Interaktion und Kommunikation zu intensivieren und damit einen ersten Schritt zur Realisierung einer globalen Rechtsgemeinschaft, des „öffentlichen Menschenrecht[s] überhaupt“, zu tun (VIII: 360), das heißt das Gegenteil eines Isolationismus, der rassistisch motiviert sein könnte. Dabei darf nicht verkannt werden, dass es in der Hand ihrer Adressaten liegt, dass unter dem Weltbürgerrecht Besuchsanfragen auch abgeschlagen werden können.
3.
Um die Argumentation bis hierher zusammenzufassen: Das Interpretationsproblem liegt darin, Kants Überzeugung von der Überlegenheit weißer Menschen und seine abgestufte Rangordnung von Menschen anderer Hautfarbe mit seinem kompromisslosen Eintreten gegen den Kolonialismus zusammenzudenken. Im ersten Abschnitt ließ sich zeigen, dass sich mögliche Inkonsistenzen für seine Moralphilosophie plausiblerweise nicht auf die Rechtsphilosophie auswirken, so dass die Annahme einer universellen und gleichen weltbürgerlichen Rechtsträgerschaft als komparativ gesichert gelten kann, und zwar unabhängig davon, ob man Kleingelds These folgt, der späte Kant habe sich von seinen rassistischen Vorannahmen abgewandt. Damit ist aber nicht die Behauptung einer über das Weltbürgerrecht hinausgehenden Gleichausstattung mit Rechten oder einer rechtlichen Gleichbehandlung seiner gesetzlichen Regelung verbunden. Im zweiten Abschnitt habe ich Argumente verworfen, die wegen Kants rassistischen Theorieansätzen und Bemerkungen in seinen Vorlesungen seinen Antikolonialismus grundsätzlich in Frage stellen. Es trifft zu, dass rassistisches Denken in den historischen Legitimationsstrategien des Kolonialismus eine wichtige Rolle spielt, aber diese Feststellung, auf Kant projiziert, verweigert sich dem Interpretationsproblem. Anders wäre es, wenn rassistisches Denken im Falle Kants einen Beitrag zur Legitimation des Anti-Kolonialismus lieferte. Die aussichtsreichste Variante der zweiten Interpretationsstrategie, auch wenn im Fall der Vermeidung von Mischehen ein Übergewicht von Gründen gegen sie spricht, ist daher die, das Weltbürgerrecht über seine möglichen odiosen Begründungen zu relativieren. In diesem Abschnitt versuche ich zu argumentieren, dass Kant die Elemente einer anderen verwerflichen Begründung versammelt, ohne sich davon zu distanzieren.
Dazu ist zu zeigen, dass „Kants Gebrauch des Begriffs der ‚Rasse‘ konsistent ist mit seiner anti-kolonialen Rechtstheorie“ (Eberl 2019: 407f.). Eberl unterstellt dabei, dass sich Kant seit Mitte der 1780er Jahre von einem Vertreter des Rassismus zu einem des naturforschenden racialism geläutert habe. Dagegen habe ich oben ausgeführt, dass Kants racialism unabtrennbare rassistische Implikationen hat, so dass er sich nicht von letzterem verabschieden und ersteren beibehalten kann.20 Gleichwohl lässt sich Eberls These in der verschärften Lesart aufrechterhalten, dass Kants ‚Rassen’lehre mit seinem Anti-Kolonialismus nicht nur konsistent, sondern kohärent ist. Oben hatte ich ihre proto-biologische Argumentation als modale Vorstellung skizziert, weil die Auffassung einer irreversiblen erblichen Entwicklung angeborener Anlagen die künftige Entwicklungsfähigkeit nicht-europäischer Menschen ausschließt. Damit wäre Kants Verallgemeinerung, die Völker Afrikas und die Ureinwohner Amerikas könnten „sich nicht selbst regieren“ (XV: 878), weniger eine versuchte zeitgenössische Bestandsaufnahme oder ein Hinweis auf die Vorzugswürdigkeit europäischer Herrschaft als eine prospektive Aussage über mögliche Zukünfte, die seine biologistischen Studien unterfüttern soll. Tatsächlich sind Kants ‚rassen’theoretische Erwägungen über die unumkehrbare Entwicklung von „Keimen“ geeignet auszuschließen, dass beliebige Menschen zu beliebigen zivilisatorischen Standards gelangen können. In seinem wichtigsten Aufsatz zum Thema, Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie von 1788, bekräftigt er seine Überzeugung, bestimmte charakterliche Merkmale wie etwa eine angeborene Trägheit seien ebenso permanent erblich und unveränderlich wie die Hautfarbe (VIII: 174 fn.). Damit bestätigt er seine frühere Auffassung, dass die Anpassung an klimatische Bedingungen erbliche Einschränkungen mit sich bringt: „Also müssen sich die Keime, die ursprünglich in den Stamm der Menschengattung zu Erzeugung der Racen gelegt waren, schon in der ältesten Zeit nach dem Bedürfnis des Klimas, wenn der Aufenthalt lange dauerte, entwickelt haben; und nachdem eine dieser Anlagen bei einem Volke entwickelt war, so löschte sie alle übrigen gänzlich aus“ (VIII: 105).
An dieser Stelle ist es erforderlich, auf Kants unterschiedliche Vorurteile gegenüber Afrikanern und Ureinwohnern Amerikas einerseits und gegenüber Asiaten andererseits zurückzukommen. Oben hatte ich darauf hingewiesen, dass Kant eine Rangordnung der Europäer und Nicht-Europäer nach ihren „Gemüthsfähigkeiten“ (II: 253) aufstellt, die die Bewohner des indischen Subkontinents über den Afrikanern, und diese über den Ureinwohnern Nordamerikas einreiht. Analog sind seine Vermutungen über ihre Fähigkeiten zur Staats- und Republikgründung als Rangordnung zu verstehen. Späten Vorlesungsmitschriften zufolge bezweifelt Kant, die Ureinwohner Kanadas könnten je in einen rechtlichen Zustand gebracht werden: „Höchstwahrscheinlich wird man diese canadische Wilden nie zu einer gesetzmäßigen Verfassung bringen können“ (Vorl. Physische Geographie Dohna (1792): MS 238; vgl. Kleingeld 2014: 51). Dagegen leistet er sich zwar ungeheuerliche Entgleisungen gegenüber den Bewohnern des indischen Subkontinents, konzediert ihnen aber nicht nur die für eine staatliche Organisation erforderliche Folgsamkeit („es ist ein sehr lenksames und leicht zu regierendes Volk“ (Vorl. Dönhoff (1782): MS 178; vgl. Kleingeld 2014: 46).21 Er bezeichnet ihre Gemeinwesen als „Staaten“ (VIII: 359) und sieht die „Hindu“-Völker als „fortgeschrittenste unter den nicht-weißen ‚Rassen‘ an, … die sich allerdings nicht zu ‚abstrakten Begriffen‘ erheben können“ (Lu-Adler 2023: 64; vgl. XXV: 1175f.). Er dementiert mithin in Bezug auf die Inder keineswegs die Errichtung eines Rechtszustands überhaupt. Allerdings hält er in Bezug auf China und Indien die politische Entwicklung durch die Einrichtung despotischer Herrschaft für abgeschlossen, zum „Stillstand“ gekommen (XV: 597). Es liegt daher nahe, Kant die Vorstellung eines Kontinuums mangelnder Eignung unterschiedlicher ‚Rassen‘ von elementaren staatlichen über rechtsstaatliche bis hin zu demokratischen Zuständen zuzuschreiben. Während er den Ureinwohnern der Amerikas und möglicherweise auch den Afrikanern die Fähigkeit zur Staatsbildung und folglich zur Demokratisierung abspricht, bezweifelt er nur Letzteres für die indische Bevölkerung.22 Sein Anti-Kolonialismus wäre gegenüber den präsumtiv nichtstaatlichen Völkern Amerikas und möglicherweise Afrikas auf Zweifel gegen deren Reproduktion von Staatlichkeit auch unter europäischer Herrschaft gebaut. In bestehenden Staaten wie den indischen Fürstentümern wäre die Errichtung fremder Herrschaft ohnehin unzulässig, allerdings wäre hier auch die notwendige Reformorientierung auf eine republikanische Entwicklung nicht gegeben, die in Kants Rechtsphilosophie die normativen Defizite gewaltorganisierender Staatlichkeit zu tilgen in der Lage ist.
Wenn Kant die potentielle Selbstregierungsfähigkeit, Rechtsstaatlichkeit oder bereits die Fähigkeit zur Staatsbildung mit oder ohne fremde Herrschaft bei zumindest einigen nicht-europäischen Gemeinwesen bestreitet, gibt ihm dies einen hinreichenden Grund für einen anti-kolonialen Ansatz, allerdings einen, der im Unterschied zum von Valdez hervorgehobenen Selbstinteresse der Europäer an der Vermeidung von Kolonialkriegen schwerlich mit den für eine egalitäre Rechtsbegründung akzeptablen normativen Gründen zusammen bestehen kann. Stützte Kant seine Argumentation auf diesen Grund, so müsste dies aufgrund seines diskriminierenden Inhalts das bisherige Verständnis des Weltbürgerrechts – als Anerkennung der gleichen Zugehörigkeit zur Menschheit in der Anerkennung unterschiedlicher Lebensverhältnisse – erschüttern.
Wie plausibel ist die Vermutung, Kant spreche sich gegen Kolonialisierung aus, weil er die Möglichkeiten kultureller, juridischer oder politischer Modernisierung und Zivilisierung zumindest einiger nicht-europäische Völker, etwa für Afrikaner und Ureinwohner der Amerikas, für notwendig begrenzt hält? Bei seinem Anti-Kolonialismus würde es sich dann um eine laissez-faire Option handeln, die im geraden Gegenteil steht etwa zu den entwicklungspolitischen Hoffnungen, die Vitoria oder James und John Stuart Mill mit einer kolonialen „Erziehungsdiktatur“ (Schefczyk) verbinden, weil Kant die Erwartung eines Aufholens und späterer Emanzipation aus biologischen Gründen für von vornherein für vergeblich hielte. Seiner Kritik kolonialer Unternehmungen erwüchse auf der Basis einer solchen Unterstellung der Vergeblichkeit eine erschreckende Konsistenz. Diese Vermutung setzt radikaler an als Valdez‘ oben erörterte Interpretation, Kant spreche sich gegen die zivilisierende Beherrschung nicht-europäischer Völker aus, weil er sich darüber im Klaren war, dass sie nur mit grausamen Mitteln zu bewerkstelligen wäre. Er spräche sich gegen Kolonialisierung aus, weil sie (wie jedes andere Mittel, das man sich vorstellen könnte) ein ungeeignetes Mittel wäre, ihr präsumtiv legitimes Ziel, die staatliche Organisation, Republikanisiserung und Zivilisierung der Menschheit, zu erreichen.
In der kritischen Literatur zu Kants ‚rassen’theoretischen Schriften wird die in diesem Abschnitt verwendete Deutung von Kants ‚Rassen’theorie breit vertreten, allerdings bisher nicht in Beziehung zum Anti-Kolonialismus gesetzt. Eine Reihe von Arbeiten schreibt Kant die Überzeugung zu, er spreche manchen nicht-europäischen Völkern gleiche Vernunftfähigkeiten ab, vermeiden es aber, die Konsequenz daraus zu ziehen. Thomas McCarthy formuliert klarer als andere, dass Kant „mutmaßte, [es] sei denkbar, dass nichteuropäische Völker nicht fähig seien, ihre Menschlichkeit in vollem Umfang selbst zu realisieren und insbesondere jene vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung zu schaffen, die die schwierigste Aufgabe sei, vor die die Natur die Menschheit gestellte habe“ (McCarthy 2015: 48). Dennoch argumentiert er, Kant lege sich die Menschheitsge-schich¬te als „hässliche Geschichte mit einem Happy-End“ zurecht, indem er den Kolonialismus, wie oben bereits zitiert, kraft seiner „Ausbreitung von Kultur und Zivilisation, Recht und Religion Europas über die übrige Welt als geeignetes Vehikel ansieht“ (ebd.: 107ff.). Dies scheint hochgradig paradox. Kant spricht dem Kolonialismus die Rechtmäßigkeit ab, während er ihn gleichzeitig als geschichtliche Macht affirmiert, weil er Ziele erreicht, die er seiner Auffassung nach gar nicht erreichen kann?23 Ein ähnlicher Selbstwiderspruch findet sich in Lu-Adlers gründlichem und umfassenden Werk. Sie führt in wünschenswerter Klarheit aus, dass Kant der Auffassung war, die Unterschiede zwischen den Menschengruppen seien nicht graduell und überwindbar, sondern er gehe von „unbridgeable and indelible difference from one race to the other“ aus (Lu-Adler 2023: 228). Dennoch vertritt sie nicht die Auffassung, eine koloniale Zivilisierungsmission sei aus Kants Perspektive absehbar erfolglos, sondern ist mit Valdez der Auffassung, „diese Rechtfertigung könne nicht universalisiert werden, ohne zugleich ‚alle Mittel zu guten Zwecken zu billigen‘“ (ebd.:, 226f.; das Binnenzitat ist aus VI: 266). Die europäische Identifizierung von Kolonialismus mit der Zivilisierung für unterlegen erklärter Völker führt dazu, dass die innere Widersprüchlichkeit der Kombination einer rassistischen Sichtweise wie der Kants mit einer kolonialismusfreundlichen Position übersehen wird.
Tatsächlich verhandelt Kant die Rechte der nicht-europäischen Völker, darunter der Nomaden auf unterschiedlichen Kontinenten, völlig unabhängig von ihrer Entwicklungsfähigkeit oder möglichen Richtungen ihrer Entwicklung. Wird von der möglichen odiosen Begründung abgesehen, zeigt sich darin „eine Einstellung reflexiver Offenheit“ angesichts kultureller Fremdheit und Differenz (Flikschuh 2017b: 349). Im Unterschied zu de las Casas und Vitoria vor ihm, zu den Mills oder auch zu Marx nach ihm lässt Kant nirgendwo durchblicken, dass es für die Kolonialisierung spräche, dass sie gleichwohl als Auslöser kultureller, technischer, ökonomischer und sozialer Entwicklung in Frage komme. Nirgendwo bekennt Kant sich zur Vermutung von McCarthy und Valdez, dass er Kolonialisierung für ein massives Unrecht hält, das aber zum Besten der unterworfenen Völker gereiche, indem sie damit eine zivilisatorische Stufenleiter emporsteigen könnten. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil sein Plan einer Weltrechtsordnung auf die zunehmende Verbreitung von Staatlichkeit, Republikanismus, und dem freiwilligen Beitritt zu einem Weltrechtssystem setzt, das durch das Weltbürgerrecht auch nicht-staatliche Völker zumindest protektiv einschließt.
Die hier vorgetragene Lesart plädiert mithin dafür, Kants Rassismus als passgenau mit der Verwerfung der verbreiteten, wohlmeinenden Rechtfertigung des Kolonialismus zu behandeln, er diene zur Entwicklung nicht-europäischer Völker. Damit behaupte ich keinesfalls, Kant akzeptiere andere Gründe für die Kolonialisierung nicht-europäischer Völker, die nichts mit universeller rechtlich-politischer Modernisierung und Zivilisierung zu tun haben. Das Weltbürgerrecht ist strikt unverträglich damit, dass Kant die Versklavung der Einwohner oder die Extraktion von Ressourcen oder Produkten als Rechtfertigungen des Kolonialismus erwogen hätte, oder dass die Herstellung von Staatlichkeit dort, wo sie durch koloniale Fremdherrschaft möglich erscheint, als hinreichende oder auch nur entschuldigende Bedingung der Gewaltanwendung ins Gewicht fiele (vgl. wiederum VI: 266). Auch auf den weiteren in der Kolonialgeschichte verwendeten Interventionsgrund der unterstellten moralischer Gräuel und „barbarischer“ Zustände verzichtet Kant, wie Eberl (2021) nachgewiesen hat, indem er den Barbareivorwurf gegen die Europäer selbst richtet. Staatliche und nicht-staatliche Völker richten sich somit in einem definitiven Pluralismus der Lebensformen ein, die Kant allerdings selbst nach dem Muster von Suprematie und Unterlegenheit beurteilt.
Es liegt daher nahe, Kant eine Art handicap-Konzeption zur Abwehr kolonialer Herrschaft zuzuschreiben, da diese aufgrund von biologischen Voraussetzungen die wesentlichen Ziele, die politische Beherrschung allererst rechtfertigen, nämlich die Einführung von Staatlichkeit, Republikanisierung und internationaler Verrechtlichung, in den nicht-europäischen Völkern nicht oder nicht vollständig erreichen könne. Nichts spricht für den gewaltsamen Versuch, ein Ziel zu erreichen, wenn die Erreichung dieses Ziels ausgeschlossen ist. Im Gegenteil, die ansässige Bevölkerung gewinnt daraus unabdingbare Rechtsansprüche, nicht verdrängt, in ihrer Lebensweise und ihren landwirtschaftlichen Praktiken nicht überformt zu werden und sich interventionsfrei auch unterhalb der Schwelle staatlicher oder demokratischer Ordnungsbildung zu organisieren. Analog der Figur natürlicher oder bürgerlicher Unselbständigkeit im Staatsrecht sollen diese weltbürgerrechtlichen Ansprüche im Zustand sozusagen unverschuldeter Unmündigkeit geschützt werden. Solche handicap-Konzeptionen sind in der Geschichte der Etablierung von Toleranzargumenten nicht unbekannt, aber nicht stets mit Diskriminierung verbunden. So verweist etwa Locke auf die kognitive Unmöglichkeit, willkürlich von einem Glauben zum anderen überzutreten, und leitet daraus die Respektierung derer ab, die nicht anders können (Locke 1996). Die verbleibende Frage ist daher, inwiefern die Extension des Weltbürgerrechts durch eine solche odiose Begründung affiziert werden könnte.
Diese Frage lässt sich an einer Extrapolation, die Pauline Kleingeld am Weltbürgerrecht vorgenommen hat, erörtern. Kleingeld liest wie viele andere Interpretinnen und Interpreten das Weltbürgerrecht als Vindizierung eines geschützten Flüchtlingsstatus, der eine Abweisung nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen zulässt, nicht aber ein permanentes Aufenthaltsrecht garantiert. Wie oben bereits erwähnt, klafft ein „Abgrund“ zwischen dem so vindizierten universellen Flüchtlingsstatus und einem verweigerten allgemeinen Migrationsrecht (Benhabib 2008: 47). Aus der Logik der Hospitalität als Besuchsrecht ergibt sich, dass Staaten und Individuen zwar universelle Bewerbungen um Austausch und Gemeinschaft zulassen müssen, aber eine sehr weitgehende Entscheidungsfreiheit darüber besitzen, welche Kontaktaufnahmen sie annehmen und welche Versuche von Menschen, sich zur „Gemeinschaft“ anbieten, sie akzeptieren. Kleingeld versucht, solchen Einschränkungsmöglichkeiten zumindest eine systematische Grenze abzuringen, indem sie nach den Gründen für eine Abweisung fragt: Dürfen diese völlig willkürlich sein? „Are states free to reject foreigners on, say, racist grounds?“ (2012: 78).
Ihre Antwort lautet: „A law that discriminates on the basis of skin color would be illegitimate, while a law that forbids persons to enter the country to sell opium or plunder its natural resources would not“ (ebd.: 79). Die Erklärung für den Ausschluss rassistischer Einreise- und Einwanderungsbeschränkungen liegt Kleingeld zufolge in der Begründung des Weltbürgerrechts. Versuchte man Antragsteller auf der Basis ihrer Hautfarbe abzuweisen, so verstieße dies gegen ihr Recht auf Kontaktaufnahme. Werde ihr Anliegen „aus willkürlichen Gründen zurückgewiesen, so würde das Recht, eine Kontaktaufnahme zu versuchen, seines Sinns entleert“ (ebd.: 79). Es ist wichtig zu betonen, dass es hier nicht um mögliche Einschränkungsgründe einer humanitären Aufnahme geht. Nach der oben vorgelegten Interpretation ist der Kernbereich des Weltbürgerrechts auf der Basis menschlicher Vulnerabilität (und nicht bloß politischer Verfolgung wie im klassischen Asylrecht und im Völkerrecht des non-refoulement) für die Angehörigen der Menschheit rechtlich und, wie Kant betont, nicht bloß philanthropisch abgesichert, so dass eine Einschränkung auf der Basis arbiträrer Gruppenzugehörigkeit ausgeschlossen ist. Es geht auch nicht darum, dass das Recht für alle, Angebote zu machen, Visa zu beantragen, sozusagen Bewerbungen um Interaktion und Aufnahme abzugeben, eingezogen würde. Es würde vielmehr „seines Sinns entleert“, wenn ein Staat etwa entscheiden könnte, keine Antragsteller aus einem Land aufzunehmen, ihre Anfragen also stereotyp regelhaft verneinte.24 Gesetzt, ein Staat erfüllte sowohl die humanitäre Bedingung und garantiere die formale Antrags- und Kommunikationsfreiheit, so fragt sich, ob Politiken, die das Aufenthalts- oder Ansiedlungsrecht auf eine auf Hautfarbe, Abstammung oder Herkunft bezogene Weise restriktiv auslegen, gegen das Weltbürgerrecht verstoßen. Auf der Basis der hier vorgelegten Analyse ist es nicht mehr offensichtlich, dass Kants Weltbürgerrecht in seiner Formulierung oder seinem Sinn nicht mit rassistischen Einreise- und Einwanderungsbeschränkungen verbinden lässt. Damit ist nicht, wie bei der Unterstellung natürlicher oder bürgerlicher Unselbständigkeit, eine Ausstattung mit weniger oder anderen Rechten verträglich, wohl aber das Risiko legaler Diskriminierung trotz dieser Rechte. Angesichts der vorgetragenen Argumente dürfte damit die Beweislast wieder auf Seiten einer nicht nur universalistischen, sondern universalistisch-egalitären Interpretation des Weltbürgerrechts liegen.
4.
Die folgende Schlussbemerkung kann nur vorläufige Überlegungen über die Folgen für uns Heutige andeuten. Eine offensichtliche Lehre, die bereits vielfach gezogen wurde und sich auch aus der vorgelegten Argumentation ergibt, ist die Interpretationsbedürftigkeit universalistischer Kategorien, die oft vorschnell mit unserem heutigen Verständnis der moralischen und politischen Gleichheit der Geschlechter, Herkünfte und Hautfarben identifiziert und auf in der Theoriegeschichte nicht vorgesehene Anwendungsfälle hin erweitert werden. Gegen systematisierende Interpretationen ist auch gar nichts zu sagen, soll die Theoriegeschichte doch nicht historistisch verwässert werden – es muss allerdings, wie Kants Weltbürgerrecht zeigt, die Gefahr umgangen werden, dass solche Extrapolationen durch unentdeckt gebliebene verwerfliche Annahmen oder Gründe unterminiert werden. Wir wissen nach alldem, dass Kant alle meint, wenn er im Blick auf das Weltbürgerrecht „alle“ sagt, aber den Kritikerinnen Gani, Dhawan, Valdez, McCarthy und Eberl ist darin zu folgen, dass er damit nicht bereits auch eine gesetzliche Gleichstellung für alle oder gar denselben Wert der Rechte für alle vorsieht. Die Kritik vorschneller Extrapolation ist etwas anderes als der von Allais kritisierte „moralisierte Selbstbetrug“ des Theoretikers Kant wie auch seiner Leser, die für sich eine moralisch einwandfreie Position in Anspruch nehmen, sich aber nicht bewusst machen „how pervasive [racism] can be in a person’s belief system and resistant to evidence — as shown by the possibility of a person’s not noticing obvious contradictions in their thinking“ (Allais 2016: 20). Es geht nicht um die Kritik von sich selbst nicht völlig transparenten Wesen oder das Ausräumen widersprüchlicher Positionen. Es geht vielmehr um das Aufspüren und Ausschalten falscher Gründe auch dort, wo sie konsistent sind mit attraktiven Positionen, die von ihnen ins Zwielicht gesetzt werden.
Um die Frage zu beantworten, ob es möglich und sinnvoll ist, in heutigen Ansätzen an Kants Weltbürgerrecht anzuknüpfen, ist es daher entscheidend, uns zu vergewissern, ob ein Weltbürgerrecht, das kohärent ist mit diskriminierenden Gründen für das Einräumen rechtlicher Ansprüche, selbst diskriminierende Merkmale transportiert. Nach dem Durchgang durch die beiden dominierenden Lesarten lässt sich sagen, dass die Kategorie universalistisch verfasst ist, die Zugehörigkeit zur Menschheit als Kriterium für eine strenge, aber eng umschriebene Ausstattung mit Rechten fasst und keine offen diskriminierenden Gehalte enthält. Wie die Erörterung von Kleingelds Beispiel rassistischer Einwanderungs-Einschränkungen zeigt, könnte sie dies aber verdeckt tun, falls falsche Gründe nicht aufgespürt und ihre Relevanz und Akzeptabilität bestritten werden, sondern – bewusst oder unbewusst – deren Weitergeltung perpetuiert oder ihnen zumindest nicht widersprochen wird. Kant stützt sich in seiner Kritik auf die Grenzen naturrechtlicher Niederlassungsansprüche und skandalisiert die Verbrechen des zeitgenössischen Kolonialismus als die einer unrettbaren Gewaltpraxis. Er braucht daher mögliche eigene Gründe gegen eine unterstellte Vergeblichkeit des Kolonialismus nicht offenzulegen. Sein weltpolitisches Programm wird durch diese nicht insgesamt kompromittiert, aber es muss deutlich gemacht werden, dass sich ein solches Programm auf stärkere Begründungen stützen und vor allem die Ableitung schein-egalitärer Implikationen vermeiden muss.25
Literatur:
- Allais, Lucy 2016: Kant’s Racism. In: Philosophical Papers 45(1-2), 1-36.
- Aristoteles 1998: Politik. München: dtv.
- Benhabib, Seyla 2008: Die Rechte der Anderen. Berlin: Suhrkamp.
- Bernasconi, Robert 2001: Who Invented the Concept of Race? Kant’s Role in the Enlightenment Construction of Race. In: Bernasconi, Robert, Hg., Race. Oxford: Blackwell, 11-46.
- Bernasconi, Robert 2002: Kant as an Unfamiliar Source of Racism. In: Ward, Julie/Lott, Tommy, Hg., Philosophers on Race. Oxford: Oxford University Press, 145-166.
- Bernasconi, Robert 2011: Kant’s Third Thoughts on Race. In: Elden, Stuart/Mendieta, Eduardo, Hg., Reading Kant’s Geography. Albany: State University of New York Press, 291-318.
- Biskamp, Floris 2017: Rassismus, Kultur und Rationalität: Drei Rassismustheorien in der kritischen Praxis. In: Peripherie 146/147, 271-296.
- Bohman, James 1994: Die Öffentlichkeit des Weltbürgers: Über Kants ‚negatives Surrogat‘. In: Bohman, James/Lutz-Bachmann, Matthias, Hg., Frieden durch Recht: Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 87-113.
- Brandt, Reinhard 1982: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre. In: Ders., Hg., Rechtsphilosophie der Aufklärung. Berlin: De Gruyter, 233-285.
- Dhawan, Nikita 2017: Can Non-Europeans Philosophize? Transnational Literacy and Planetary Ethics in a Global Age. In: Hypatia 32(3), 488-505.
- Eberl, Oliver/Niesen, Peter 2011: Kommentar. In: Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden und Auszüge aus der Rechtslehre. Berlin: Suhrkamp..
- Eberl, Oliver 2019: Kant on Race and Barbarism: Towards a More Complex View on Racism and Anti-Colonialism in Kant. In: Kantian Review 24, 385-413.
- Eberl, Oliver 2021: Naturzustand und Barbarei: Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus. Hamburg: Hamburger Edition.
- Eze, Emmanuel Ch. 1994: The Colour of Reason: the Idea of ‚Race‘ in Kant’s Anthropology. In: Faull, Katherine M., Hg., Anthropology and the German Enlightenment. Lewisburg: Bucknell University Press, 200-241.
- Fanon, Frantz 2022: Rassismus und Kultur. In: Ders., Für eine afrikanische Revolution. Hgg. von Barbara Kalender. Berlin: März, 45-64.
- Fine, Sarah 2016: Immigration and Discrimination. In: Ypi, Lea/Fine, Sarah, Hg., Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership. Oxford: Oxford University Press, 125-150.
- Firla, Monika 1997: Kants Thesen vom “Nationalcharakter” der Afrikaner, seine Quellen und der nicht vorhandene ‘Zeitgeist’. In: Rassismus und Kulturalismus. IKW-Mitteilungen 52(3), 7-17.
- Flikschuh, Katrin/Ypi, Lea (2014): Hg., Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Flikschuh, Katrin 2017a: What is Orientation in Global Thinking? Cambridge: Cambridge University Press.
- Flikschuh, Katrin 2017b: Kant’s nomads: encountering strangers. In: Con-Textos Kantianos 5, 346-368.
- Gani, Jasmin K. 2017: The Erasure of Race: Cosmopolitanism and the Illusion of Kantian Hospitality. In: Millennium: Journal of International Studies 45(3), 425-446.
- Habermas, Jürgen 2009: Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine Chance? In: Ders., Politische Theorie. Philosophische Texte, Bd. 4. Berlin: Suhrkamp, 313-401.
- Herb, Karlfriedrich 2018: Unter Bleichgesichtern: Kants Kritik der kolonialen Vernunft. In: Zeitschrift für Politik 65(4), 381-398.
- Höffe, Otfried 2020: War Kant ein Rassist? In: Neue Zürcher Zeitung vom 15.07.2020 [https://www.nzz.ch/meinung/war-kant-ein-rassist-ld.1562781] (Zugegriffen: 05. Juli 2023).
- Huber, Jakob 2022: Kant’s Grounded Cosmopolitanism. Oxford: Oxford University Press.
- Huseyinzadegan, Dilek 2022: Charles Mills’ ‘Black Radical Kantianism’ as a Plot Twist for Kant Studies and Contemporary Kantian-Liberal Political Philosophy. In: Kantian Review 27(4), 651-665.
- Kant, Immanuel 1900ff: Gesammelte Schriften. Bd. 1-22, hgg. von der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 23 hgg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Ab Bd. 24 hgg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin, Leipzig: De Gruyter.
- Kleingeld, Pauline 2007: Kant’s Second Thoughts on Race. In: Philosophical Quarterly 229, 573-592.
- Kleingeld, Pauline 2012: Kant and Cosmopolitanism: The Philosophical Ideal of World Citizenship. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kleingeld, Pauline 2014: Kant’s second thoughts on colonialism. In: Flikschuh, Katrin/Ypi, Lea, Hg., Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 43-67.
- Kraut, Richard 2002: Aristotle: Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
- Larrimore, Mark 1999: Sublime Waste: Kant on the Destiny of the ‚Races’. In: Wilson, Catherine, Hg., Civilization and Oppression. Calgary: Calgary University Press, 99-125.
- Locke, John 1996: Ein Brief über Toleranz. Hamburg: Meiner.
- Louden, Robert 2002: Kant’s Impure Ethics: From Rational Beings to Human Beings. Oxford: Oxford University Press.
- Lu-Adler, Huaping 2023: Kant, Race and Racism: Views from Somewhere. New York: Oxford University Press.
- Maus, Ingeborg 1992: Zur Aufklärung der Demokratietheorie: Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluss an Kant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- McCarthy, Thomas 2015: Rassismus, Imperialismus und die Idee menschlicher Entwicklung. Berlin: Suhrkamp.
- Meckstroth, Christopher 2018: Hospitality, or Kant’s Critique of Cosmopolitanism and Human Rights. In: Political Theory 46(4), 537-559.
- Mills, Charles W. 2005: Kant’s Untermenschen. In: Valls, Andrew, Hg., Race and Racism in Modern Philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 169-193.
- Mills, Charles W. 2018: Black Radical Kantianism. In: Res Philosophica 95(1), 1-33.
- Muthu, Sankar 2003: Enlightenment against Empire. Princeton: Princeton University Press.
- Niesen, Peter 2005: Kants Theorie der Redefreiheit. Baden-Baden: Nomos.
- Niesen, Peter 2007: The ‘West divided’? Bentham and Kant on Law and Ethics in Foreign Policy. In: Chandler, David/Heins, Volker, Hg., Rethinking Ethical Foreign Policy. London, New York: Routledge, 93-115.
- Niesen, Peter 2014: Restitutive Justice in International and Cosmopolitan Law. In: Flikschuh, Katrin/Ypi, Lea, Hg., Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 170-196.
- Niesen, Peter 2017: ‘What Kant would have said in the Refugee Crisis’. In: Sørensen, Asger, Hg., Kant and the Establishment of Peace. Danish Yearbook of Philosophy, Bd. 50. Leiden: Brill, 83-106.
- Niesen, Peter 2021: Vulnerability, Space, Communication: Three Conditions of Adequacy for Cosmopolitan Right. In: Herlin-Karnell, Ester/Rossi, Enzo, Hg., The Public Use of Coercion and Force. Oxford: Oxford University Press, 64-77.
- Pascoe, Jordan 2022: Kant’s Theory of Labour. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pitts, Jennifer 2006: A Turn to Empire: The Rise of Liberal Imperialism in Britain and France. Princeton: Princeton University Press.
- Reinhardt, Karoline 2019: Migration und Weltbürgerrecht: Zur Aktualität eines Theoriestücks der politischen Philosophie Kants. Freiburg, München: Karl Alber.
- Ripstein, Arthur 2009: Force and Freedom: Kant’s Legal and Political Philosophy. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Ripstein, Arthur 2021: From Constitutionalism to War and Back Again. In Herlin-Karnell, Ester/Rossi, Enzo, Hg., The Public Use of Coercion and Force. Oxford: Oxford University Press, 229-333.
- Rölli, Marc 2011: Kritik der anthropologischen Vernunft. Berlin: Matthes & Seitz.
- Schefczyk, Michael 2017: “Die wahre Theorie der Regierung eines zivilisierten Landes über eine halbbarbarische Kolonie” – John Stuart Mill über Kolonialismus und die East India Company. In: Jacob, Daniel/Ladwig, Bernd/Schmelzle, Cord, Hg., Normative Fragen von Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit. Schriftenreihe der Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte in der DVPW, Bd. 34. Baden-Baden: Nomos, 237-266.
- Schild, Wolfgang 1981: Freiheit – Gleichheit -’Selbständigkeit’ (Kant): Strukturmomente der Freiheit. In: Schwartländer, Johannes, Hg., Menschenrechte und Demokratie. Kehl, Straßburg: Engel, 135-176.
- Stilz, Anna 2014: Provisional Right and Non-State Peoples. In: Flikschuh, Katrin/Ypi, Lea, Hg., Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 197-220.
- Stilz, Anna 2016: The Value of Self-Determination. In: Sobel, David/Vallentyne, Peter/Wall, Steven, Hg., Oxford Studies in Political Philosophy, Bd. 2. Oxford: Oxford University Press, 98-127.
- Willaschek, Marcus 1997: Why the ‘Doctrine of Right’ does not belong into the ‘Metaphysics of Morals’: On some Basic Distinctions in Kant’s Moral Philosophy. In: Byrd, Sharon B./Hruschka, Joachim/Joerden, Jan C., Hg., Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 5. Berlin: Duncker & Humblot, 205-227.
- Valdez, Ines 2017: It’s Not about Race: Good Wars, Bad Wars, and the Origins of Kant’s
- Anti-Colonialism. In: American Political Science Review 111 (4), 819–834
- Williams, Howard 2007: Kant’s Political Philosophy: Kantian Cosmopolitan Right. In: Ethics and Politics Review/Journal of International Political Theory 3 (1), 57-72.
- Ypi, Lea 2014: A Permissive Theory of Territorial Rights. In: European Journal of Philosophy 22(2), 288-312.
- Zorn, Daniel-Pascal 2021: Tagung zu Immanuel Kant: War der große Philosoph doch ein Rassist? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.01.2021 [www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/rassismus-bei-kant-war-der-grosse-philosoph-doch-ein-rassist-17153249.html] (Zugegriffen: 18. Juli 2023).
1. Ich verwende in diesem Beitrag das generische Maskulinum, um keine sprachliche Vorentscheidung im Hinblick auf die Universalität der in Frage stehenden Rechte und Ermächtigungen zu treffen. Meine Vermutung ist, dass alle Geschlechter sich ohne Unterschied auf das kantische Weltbürgerrecht berufen können, muss diese Frage und die nach der Bestimmung seiner Extension aber hier offenlassen.
2. Auch meine eigenen früheren Arbeiten zum Weltbürgerrecht sind durch die Ausblendung des möglichen Zusammenhangs zwischen rassistischer Anthropologie und kosmopolitischer Rechtstheorie gekennzeichnet. Jasmin Gani (2017: 434) kritisiert daher zutreffend: „Niesen does highlight Kant’s anti-imperialism, but his detailed analysis also serves to emphasise the absence of any discussion of racial logics that prevailed at the time“. Die Reflexion meiner eigenen Arbeiten im Verlauf der Erstellung dieses Beitrags bringen mich dazu, öfter auf sie zu verweisen als professionell üblich.
3. Ein frühes Zeugnis der deutschsprachigen Diskussion ist Firla 1997. Vgl. die resümierende Darstellung der Debatte bei Herb 2018. Aus der Chronologie und Entwicklung von Kants Denken hat Oliver Eberl differenzierte Schlüsse gezogen (vgl. Eberl 2021: 316-364).
4. Eine konsolidierte Liste der englischsprachigen Literatur existiert bei der North American Kant Society: Resources on Kant on Race and Racism [https://northamericankantsociety.org/resources-on-Kant-race-and-racism](Zugegriffen: 08. Juli 2023).
5. Für einen historischen und analytischen Kommentar vgl. Eberl/Niesen 2011: 114-118, 251-269. Ich verzichte im vorliegenden Beitrag darauf, mich auf meine anderswo entwickelte Interpretation, dass das natürliche Weltbürgerrecht bei Kant als provisorisch zu verstehen und in eine extensive, peremtorisch positive Gestalt zu überführen ist, zu stützen (Niesen 2017). Ich kann hier die Begründung nicht nachholen; auch sind inzwischen ernstzunehmende Einwände geltend gemacht worden (vgl. Ripstein 2021: 266-269).
6. Kants Schriften werden im Folgenden nach der Akademieausgabe mit Bandnummer und Seitenangabe zitiert.
7. Das geistesgeschichtliche Vorbild dazu ist Aristoteles‘ (1998: Kap. 1) proto-genetische Unterscheidung zwischen Griechen und Barbaren (vgl. dazu Kraut 2002: 277-305).
8. Das philosophiegeschichtliche ebenso wie realhistorische Beispiel für letzteres ist John Stuart Mill (vgl. Schefczyk 2017).
9. Kleingelds These, dass sich der späte Kant antikolonial radikalisierte, wird mit unterschiedlichen Argumenten auch von Eberl (2019) und Muthu (2003: 181) verfochten.
10. Als Reaktion auf Kleingelds Interpretation vergleiche Bernasconi 2011.
11. Lucy Allais (2016: 5-6) diagnostiziert keinen Widerspruch zwischen Kants Rassismus und seiner „universal moral theory“. Huaping Lu-Adler (2023: 34f.) widerspricht der These, dass es einen fundamentalen Widerspruch zwischen dem Universalismus von Kants Moraltheorie und seiner raciology gebe, geht aber selbst nicht auf mögliche Implikationen für die rechtliche Ausstattung unterschiedlicher Menschengruppen ein.
12. Beiträge, die dies bestreiten, sind Willaschek (1997), Niesen (2005) und Maus (1992).
13. Die weitestgehende Rationalisierung ist immer noch Schild 1981. Eine kritisch-intersektionale Interpretation findet sich jetzt bei Pascoe 2022.
14. Es ließe sich einwenden, dass das universelle Kommunikationsrecht als „negatives Surrogat“ des Staatsbürgerrechts auf globaler Ebene zu verstehen ist (so zuerst Bohman 1994). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der politische Gebrauch globaler Kommunikationsfreiheit auf die Verletzung des Weltbürgerrechts reagiert (weil eine „Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“ VIII: 360), also als Reflexrecht gegen non-compliance auf einer anderen Ebene angesiedelt ist als die hier erörterten Befugnisse erster Stufe.
15. Wo nicht anders angegeben, stammen alle Übersetzungen vom Verfasser.
16. Dass Kant sich gegen die Restitution ungerechtfertigter Aneignung ausspreche, lässt sich mit einem Hinweis auf den zweiten Präliminarartikel zum Ewigen Frieden, der den Rückweg zur vorher bestehenden Rechtslage zwischen Staaten aufzeigt, schon für das Völkerrecht widerlegen. (VIII: 344, 347; vgl. auch Niesen 2014).
17. Die Schlüsselpassage ist, dass Kolonien aufgrund ihres mangelnden wirtschaftlichen Erfolgs nur der „Bildung der Matrosen für Kriegsflotten, und also wieder zu Führung der Kriege in Europa dienen“ (VIII: 359).
18. Robert Louden (2002: 97) führt eine ähnlich zweifelhafte Stelle aus Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie an, in der sich Kant gegen „Vermischungen“ ausspricht, die sich aber auf die Verwandtenehe und nicht auf Mischehen bezieht.
19. Vgl. Niesen 2021: 70. Ich kann hier nicht auf die komplizierte Debatte um das „China und Japan“-Problem eingehen. China und Japan, „die den Versuch mit solchen [europäischen] Gästen gemacht hatten“ (VIII: 359), schließen ihre Grenzen laut Kant „weislich“ gegenüber anlandenden Europäern, das heißt auch gegenüber denen mit Heiratsabsichten – die herrschende Lesart, dass sich dies ihren Erfahrungen mit kolonialer Aggression verdankt (Williams 2007; Reinhardt 2019: 120-124), scheint mir weithin überzeugend zu sein, aber gerade kein allgemein-prospektives Interaktionsverbot nicht-kolonisierter Staaten zu rechtfertigen.
20. Eine ausführliche Dokumentation des Umstands, dass Kant stets eine „Korrelation“ zwischen erblicher Hautfarbe und makropsychologischen Merkmalen annahm, findet sich bei Lu-Adler 2023.
21. Die beiden Vorlesungen Dönhoff und Dohna werden hier nach ihrer Dokumentation durch die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften zitiert: [https://webarchive.bbaw.de/default/20210108100620/http:/kant.bbaw.de/base.htm/geo_base.htm], ©Werner Stark.
22. Zum Zusammenhang von Verrechtlichung und Demokratisierung bei Kant kann ich hier nur abstrakt darauf verweisen, dass für Kant Staatlichkeit nur eine provisorische Rechtfertigung genießt. Sie bezieht ihre Legitimität aus ihrer inneren Ausrichtung auf Republikanisierung, also demokratische Selbstherrschaft, deren Realisierung nur auf das Vorliegen günstiger äußerer Bedingungen aufgeschoben werden kann (VIII: 372ff.; vgl. Maus 1992).
23. In Bezug auf Kants Sichtweise der Versklavung von Afrikanern formuliert McCarthy ein analog paradoxes Argument: „Zusammen mit seinen wiederholten Äußerungen über die inhärente Inferiorität der Afrikaner […] und ihre angeborene Unfähigkeit, sich über den Naturzustand zu erheben, erlaubt dies die Folgerung, dass Kant aus einer historisch-entwicklungsmäßigen Perspektive in der Sklaverei eines jener Übel erblickte, die zur Entwicklung der menschlichen Rasse durch die Ausbreitung der europäischen Kultur beitrugen, gleichsam als Element von deren ‚zivilisatorischer Mission‘“ (McCarthy 2015: 111f.).
24. Zur Frage rassistischer Einwanderungsrestriktionen vgl. Fine 2016.
25. Mit Dank an Hans-Jörg Sigwart, Jakob Hoffmann, Daniel Häuser und insbesondere Oliver Eberl für ihre hilfreichen Anmerkungen.
Peter Niesen,
ist Professor für Politische Theorie an der Universität Hamburg. Von 2006 bis 2013 war er Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Darmstadt. 2007 war er ein Gründungsmitglied des Exzellenz-Clusters Normative Orders an der Goethe-Universität, wo er 1998 promovierte und 2005 habilitierte. Mit Oliver Eberl veröffentlichte er 2011 den Kommentarband Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden/Auszüge aus der Rechtslehre. Seine jüngste Veröffentlichung, Zur Diagnose demokratischer Regression, erschien 2023 im Leviathan Sonderband.