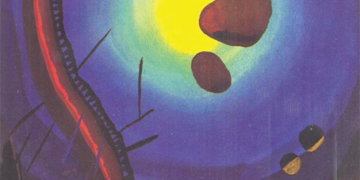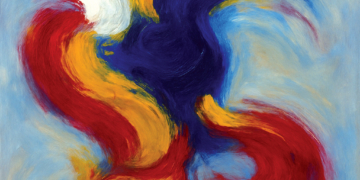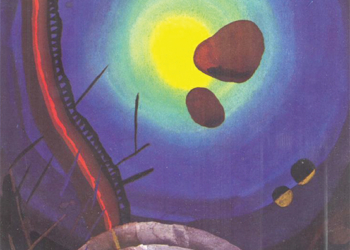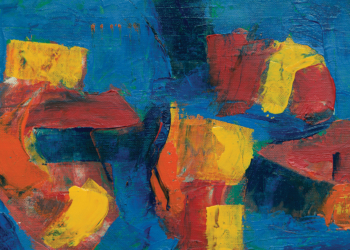Der Terminus der kopernikanischen Wende ist zwar im Anschluss an die Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft in Umlauf geraten (KrV, B XVI u. B XXII), lässt sich aber sinnvoll auch mit Blick auf Fragen der Moralphilosophie und Theologie verwenden, sofern sie mit der überlieferten Metaphysik vor Kant verwoben sind.
I.
Mit Blick auf den Transzendentalismus der Erkenntnistheorie kann man von einer kopernikanischen Wende in Kants Denken sprechen. Schon die Übertragung dieser Rede aus dem Bereich der Astrophysik auf die Erkenntnistheorie setzte als tertium comparationis voraus, dass sich die – auf menschlichen Erkenntnisleistungen beruhende – Erforschung der Welt überhaupt einer Leistung der Vernunft verdankt. Das gilt für die Erkenntnis, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, ebenso wie für „den sicheren Gang der Wissenschaft“ überhaupt.1 Und der beruht auf Erfahrung, die Kant als „Erkenntnisart“ begreift, „dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin apriori voraussetzen muss“ (KrV, B XVII). Dass apriorische Voraussetzungen die Erkenntnis begründen, stellt bislang überlieferte Gewohnheiten im Denken, Interpretieren und Verstehen der Phänomene in Frage.
Der Terminus der kopernikanischen Wende ist zwar im Anschluss an die Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft in Umlauf geraten (KrV, B XVI u. B XXII), lässt sich aber sinnvoll auch mit Blick auf Fragen der Moralphilosophie und Theologie verwenden, sofern sie mit der überlieferten Metaphysik vor Kant verwoben sind. Denn einer Leistung praktischer Vernunft verdankt sich bei Kant auch die Selbsterforschung des Menschen als eines moralischen Wesens. Ethische Leitlinien sind zwar in narrativen Formen und Regeln überliefert – wie etwa in den Geboten und Geschichten der Bibel. Will man aber – wie Kant – das Sittengesetz aus praktischer Vernunft allein ableiten, so muss es „grundgelegt“ werden durch ein Subjekt, das sich eben dieser Vernunft bedient.2 Ohne dass es sich hierbei hinsichtlich seines Vernunft- und Verstandesgebrauchs ernst genug nähme, wäre keine Erkenntnis der Welt und des Menschen, aber auch keine Selbstbeschränkung dieser Erkenntnis möglich.
Diese Selbstbeschränkung richtete sich auf Fragen der Metaphysik, die die theoretische Vernunft auf sich beruhen lassen musste, weil sie sie nicht beantworten konnte. Doch während sich die Metaphysik in diesem Bereich „gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt“ (KrV, B XIV), gesteht die praktische Vernunft ihr für die Grundlegung der Sitten eine bleibende Funktion und Bedeutung zu. Deutlich genug ist das am hier leitenden Begriff der Freiheit zu sehen, die uns, „obgleich sie nichts Übernatürliches in ihrem Begriffe enthält, gleichwohl ihrer Möglichkeit nach […] ebenso unbegreiflich […] als das Übernatürliche [bleibt], welches man zum Ersatz der selbsttätigen, aber mangelhaften Bestimmung derselben annehmen möchte.“3 Freiheit ist also kein Phänomen, das in der Welt vorkommt wie andere Phänomene, sondern muss als Idee vorausgesetzt werden, damit die Ethik in einem kritischen Sinne grundgelegt werden kann.
Freiheit ist also kein Phänomen, das in der Welt vorkommt wie andere Phänomene, sondern muss als Idee vorausgesetzt werden, damit die Ethik in einem kritischen Sinne grundgelegt werden kann.
Diese leitenden Überzeugungen stehen in Kants Religionsphilosophie in Geltung, die sich anschickt, den überlieferten Offenbarungs– beziehungsweise spezifischer in der späten Religionsschrift: den Kirchenglauben in einen reinen Religionsglauben zu übersetzen.4 Bekanntlich vollzieht Kant diese Übersetzung so, dass er ein Doppeltes zeigt: zum einen, wie die aus dem Moralgesetz folgenden Pflichten „als göttliche Gebote“5 angesehen werden können, zum anderen, wie die überlieferten Gebote Gottes, des „moralischen Gesetzgebers“, als „wahre Pflichten“ zu verstehen sind.6 Es handelt sich um einen wechselseitigen Übersetzungsvorgang zwischen der positiven religiösen Überlieferung und des apriorisch vor aller Lektüreerfahrung dieser Texte aus reiner praktischer Vernunft, unter Voraussetzung der Freiheit und nach der Methode der Autonomie erzeugten „Sittengesetzes“ in Gestalt des kategorischen Imperativs.7
Im Zuge dieses Übersetzungsprozesses forderte auch die christlich überlieferte Lehre vom Bösen ihre eigene Bearbeitung. Kant nimmt diese Schwierigkeit zum Anlass, die Grundlegung eines Handelns aus Freiheit, wie er sie in seiner praktischen Philosophie vorgenommen hatte, einer Prüfung zu unterziehen. Und diese führt, um es kurz zu sagen, zu dem Ergebnis, dass der Mensch nicht selbstverständlich das nach vernünftiger Einsicht Gute tut. Er kann auch aus Freiheit Böses tun – wider alle bessere Einsicht.8
II.
Um diesen Stand der Reflexion genauer nachzuvollziehen, müssen wir noch einmal zu der Wende zurück, die Kant in der Metaphysik vollzogen hatte. Sie betraf – als Konsequenz aus der praktischen Transformation der Metaphysik – auch die überlieferte Lehre vom Bösen. Schon ein nur oberflächlicher Blick auf diese Überlieferung, wie sie sich bei Leibniz maßgeblich zusammengefasst findet, lässt die Erschütterung ahnen, die Kants Lehre vom radikal Bösen bei nicht wenigen Rezipienten ausgelöst haben mag. Denn seine moralische Interpretation des Bösen setzt eine Kritik der Theodizee voraus.
Und diese führt, um es kurz zu sagen, zu dem Ergebnis, dass der Mensch nicht selbstverständlich das nach vernünftiger Einsicht Gute tut. Er kann auch aus Freiheit Böses tun – wider alle bessere Einsicht.
Nach Leibniz gibt es drei Übel, die alles Leid der Welt begründen:
Man kann das Uebel metaphysisch, physisch und moralisch auffassen. Das metaphysische Uebel besteht in der einfachen Unvollkommenheit; das physische Uebel in den Schmerzen und das moralische Uebel in der Sünde. Obgleich das physische und moralische Uebel nicht nothwendig sind, so genügt deren Möglichkeit in Folge der ewigen Wahrheiten, und da diese ungeheure Region von Wahrheiten alle Möglichkeiten befasst, so muss es der möglichen Welten unendlich viele geben, und das Uebel muss in mehreren derselben mit eingehen und selbst die beste muss dessen enthalten. Dies ist es, was Gott bestimmt hat, das Uebel zuzulassen.“9
Leibniz sucht das dreifache Problem der Unvollkommenheit der Welt, der Unvermeidbarkeit des Schmerzes in der Erfahrung des eigenen Körpers und der empirisch (auch in der Selbstbeobachtung) vielfach belegbaren Fehlbarkeit des Menschen durch den Gedanken der Harmonie zu lösen. Alles müsse in der von Gott geschaffenen Welt für den ebenfalls geschaffenen Menschen so zusammenstimmen, dass auch das Negative, das Andere, das Störende einbezogen wird. In der Metapher der Musik gesprochen: Disharmonien lösen sich in Harmonien auf, die ihrerseits ihre Struktur und Gestalt (und auch ihre Erhabenheit und Schönheit) dadurch gewinnen, dass sie durch die Disharmonien hindurchgegangen sind.
Wie ist Kant mit dieser metaphysischen Voraussetzung umgegangen? Auch die auf der Harmonie der Welt beruhende Theodizee – nota bene ist das ein Harmoniegedanke, der auch noch den Gottesbegriff tragen soll – ist bei Kant der Kritik unterworfen.
Unter einer Theodicee versteht man die Verteidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen jene erhebt. – Man nennt dieses, die Sache Gottes verfechten; ob es gleich im Grunde nichts mehr als die Sache unserer anmaßenden, hiebei aber ihre Schranken verkennenden Vernunft sein möchte.10
Zwei Aspekte sind mir hier bemerkenswert. Zum einen steht die Vernunft stets in der doppelten Gefahr, sich einerseits (mit Blick auf eine theoretische Welterklärung) zu überschätzen, andererseits (mit Blick auf eine praktische Handlungsorientierung) aber zu unterschätzen. Menschlicher Vernunftgebrauch setzt deshalb eine nicht endende Anstrengung der Kritik voraus, anders gesagt: Philosophie nach Kant ist kritisch nicht nur gegenüber überlieferten oder neu auftretenden Dogmatismen (an denen auch die Moderne nicht arm ist), sondern auch gegen sich selbst.
Zum anderen wird Kants Nachdenken Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee wohl nur dann zureichend zu verstehen sein, wenn es von der Überzeugung getragen ist: „Nicht Gott hat sich vor dem Forum des Menschenverstandes zu rechtfertigen, sondern der Mensch muss vor Gott gerechtfertigt werden.“11 Deutlich genug schließt Kant mit dieser Wendung der Frage nach Rechtfertigung an Martin Luther an, ebenso deutlich transformiert er aber das sola gratia der reformatorischen Lehre durch seine Ethiko-Theologie. Sie lässt den Menschen nicht durch ein allzu starkes Gnadenbewusstsein seiner Verantwortung entkommen. Vielmehr kommt es auf die Willenskräfte an, wenn der Mensch sich der ihm verliehenen Gabe der Vernunft würdig erweisen soll.12 Entsprechend sind Kant die kirchlichen „Gnadenmittel“13, die der menschlichen Schwäche und Fehlbarkeit aufhelfen sollen (und zu ihnen werden das „Kirchengehen“, die Teilnahme an den Sakramenten und das Gebet gerechnet)14, auch nicht in den Hauptstücken seiner Religionsphilosophie der Erwähnung wert, sondern nur in deren „Parerga“, ihren „Nebengeschäften“.15 In Kants Ethiko-Theologie bilden die Sprach-, Ritual- und Symbolformen der „gelebten Religion“ nur noch eine Lücke.16 Denn es geht ihm vor allem darum, dass der Mensch das selbst grundgelegte, und d.h. durch eigenes Denken gerechtfertigte Sittengesetz auch befolgt. In diesem Sinne ließe sich im Rahmen von Kants Metaphysikkritik von einer kopernikanischen Wende von der Theodizee zur Anthropodizee sprechen.

III.
Das Böse liegt nicht nur in den Umständen oder der Natur, sondern als moralische Möglichkeit im Menschen selbst – eine radikale These, die Kants Moralphilosophie tief prägt.
Wie stellt sich diese Wende dar, wenn wir nun die Lehre vom radikal Bösen in den Blick nehmen, die Kant zu Beginn seiner Religionsschrift in intensiver Anverwandlung und Transformation der christlichen Tradition entwickelt? Er hatte „das Gute und das Böse ausschließlich in den Menschen“17 als das Wesen verlagert, das zwischen beidem unterscheiden und mehr noch: Rechenschaft von den Kriterien dieser Unterscheidung geben kann.18 Dazu ist der Mensch in der Lage, weil er Vernunft hat, genauer: sofern er von seiner praktischen Vernunft Gebrauch macht. Der Versuchung einer anmaßenden, hierbei aber ihre Schranken verkennenden Vernunft (siehe oben) widersteht Kant auf eine doppelte Weise: Von der metaphysischen Bestimmung des Bösen (als Erklärung des Nicht-Erklärbaren) bleibt nicht mehr als ein „Bedürfnis“19, das zu erfüllen unsere Menschenvernunft aber überfordert – es sei denn, es handelte sich hierbei um die Grundlegung einer Ethik, die den Menschen aufgrund seines eigenen sittlichen Potentials in die Pflicht nimmt. Es bleibt aber auch das „Bedürfnis“, dem physisch Bösen zu widerstehen. Körperliche Schwäche, Krankheit und das Älterwerden gehören zur menschlichen Existenz. Und Vorsichtsmaßnahmen mit Blick auf mögliche Naturkatastrophen unterliegen menschlicher Verantwortung. Die Bedingungen dieses „Bösen“ zu verstehen und ihnen therapeutisch zu begegnen – das hat man nach Kant ohne weiteres an die im 19. Jahrhundert aufblühenden Naturwissenschaften und die Medizin delegiert.
Es liegt jedenfalls am Menschen, mit dem dreifachen Bösen umzugehen, das Leibniz unterschieden hatte. Doch nicht jeder kann Naturwissenschaftler oder Mediziner werden. In moralischer Hinsicht ist aber allen Menschen die Unterscheidung von Gut und Böse aufgetragen. Wie soll man es dann erklären, dass dennoch viele von ihnen – ja nach Kant: potentiell alle – das Böse immer noch nicht mit Gutem überwunden haben?20 Kant antwortet auf diese Frage mit seiner Lehre vom radikal Bösen, das in jedem Menschen angenommen werden müsse.21 Er nimmt die Freiheit des Menschen auch darin ernst, dass wir jederzeit gegen bessere Einsicht handeln können.
Als „gnadenloser Beobachter menschlicher Unzulänglichkeiten“ listet er die „Inkonsequenzen“ auf, die Menschen auch als „Rechtfertigungen“ für ihr vom Sittengesetz abweichendes Tun vorbringen – es sind deren drei: „Gebrechlichkeit“, „Unlauterkeit“ und „Bösartigkeit“ (RGV, B 21f.). Die Gebrechlichkeit findet Kant „in der Klage eines Apostels ausgedrückt: Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt“ (B 22). Die Unlauterkeit besteht darin, „dass pflichtmäßige Handlungen nicht rein aus Pflicht getan werden“. Und in der Bösartigkeit komme die „Verkehrtheit (perversitas) des menschlichen Herzens“ zum Ausdruck.
Wenn die Freiheit des Menschen sich aber nun nicht in einer Gesetzgebung erfüllt, die er aus Vernunft sich selbst gegeben hat, (sondern in ethisch erblindeter Interessenverfolgung), wenn sogar wider besseres Wissen, sehenden Auges gewissermaßen, das Böse gewählt wird – worauf ist dann noch die Hoffnung zu setzen? Scheitert der Mensch nicht an der kopernikanischen Wende von der Theodizee zur Anthropodizee? Die Radikalität von Kants Nachdenken über das Böse besteht in meiner Sicht darin, dass er der Gefährdung der Autonomie nicht ausweicht. Wäre er dieser Gefährdung durch Restitution der christlichen Lehre von der Erbsünde erlegen (an der er sich abarbeitet), so hätte er den Anspruch kritischer Vernunft erschüttert, ja außer Kraft gesetzt.
Doch trotz des „Hangs“ zum Bösen, den Kant dem Menschen attestiert, hält er daran fest, dass „das Gnadengeschenk der Vernunftanlage [des Menschen] […] eine Bestimmung zur Autonomie“22 ist, und dass die natürlichen, „angeborenen Neigungen von Haus aus gut und ‚unverwerflich‘“ sind. Wenn nun aber nicht in ihnen, sondern nur „in den subjektiven Gründen des Gebrauchs der Freiheit, eben in der Wahl böser Maximen“23 das Böse begründet sein kann, besteht die Hoffnung auf einen allmählichen Weg der Besserung, zu dem Bildung, aufgeklärter Geist, staatliches Recht und die Arbeit an der eigenen Gesinnung beitragen können. Kant hofft auf eine Korrespondenz zwischen den äußeren Verhältnissen in Staat und Gesellschaft, zu denen für ihn Kirche und Recht gehören, und der Entwicklung des inneren Selbstverhältnisses des Menschen, der Gesinnung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Kant zufolge befinden wir uns in einem offenen Prozess der „ins Unendliche hinausgehenden Fortschreitung vom Schlechteren zum Besseren“.24
Quellen:
- Kant, Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1976, B VII u.ö. Zit. als KrV.
- Vgl. dazu: I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga 1786 (2. Auflage).
- I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Hamburg 1978, B 297. Zit. als RGV. An anderer Stelle heißt es, Freiheit sei ein „übersinnlicher Gegenstand der Kategorie der Kausalität“ (I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg 1951, A 9. Zit. als KpV.
- Kant, RGV, B 157ff.; B. 167ff.
- Kant, KpV, A 233.
- Vgl. Kant, RGV, B 138.
- Vgl. dazu: Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
- Das hat E. L. Fackenheim in einem frühen Beitrag gezeigt (Ders., Kant and Radical Evil, in: The University of Toronto Quarterly (1954), 339–353).
- G. W. Leibniz, Die Theodizee. Übersetzt von J. H. v. Kirchmann, Berlin 2003 (=Nachdruck der Ausgabe von Dürr, Leipzig 1879), 91.
- G. Picht, Über das Böse, in: Ders., Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima Bd. II, Stuttgart 1981, 490 zit. Kant, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, nach der Akademie-Ausgabe Bd. 8, 255.
- Ebd., 490f.
- Vgl. dazu Kant, RGV, B 63: „‚Es ist nicht wesentlich und also nicht jedermann notwendig zu wissen, was Gott zu unserer Seligkeit tue, oder getan habe‘; aber wohl, was er selbst zu tun habe, um dieses Beistandes würdig zu werden.“ (Hervorhebung im Text) Wie Kant dennoch mit der Frage nach dem gnädigen Gott umgegangen ist, hat A. W. Wood ausführlich diskutiert (Ders., Kant and Religion, Cambridge 2020, 139–163). Mit einer Lehre vom unfreien Willen ist Kants Ethik jedenfalls nicht kompatibel (vgl. ebd., 153).
- Kant, RGV, B 296ff.
- Das Gebet steht in der Gefahr, als ein „Mittel“ verstanden zu werden, das „der Mensch in seiner Gewalt hat, um dadurch eine gewisse Absicht zu bewirken“ (RGV, B 298). Es steht zudem in dem Verdacht, „als Gnadenmittel gedacht“, „ein abergläubischer Wahn“ zu sein (B 302).
- Kant, RGV, B 63.
- Kant hat zwar der Kirche als „eines ethisch gemeinen Wesens“, als „eines Volkes Gottes unter ethischen Gesetzen“ (RGV, B 138f.) eine für die Pflege der Hoffnung unverzichtbare Bedeutung und Funktion zuerkannt. Von „gelebter Religion“ zu sprechen, impliziert aber ungleich mehr als dieser Begriff von Kirche.
- Picht, Über das Böse, 491.
- Die Fähigkeit zu unterscheiden ist schon in der narrativen Form von Genesis 2 angesprochen, die Rechenschaft von den Kriterien der Unterscheidung aber bedarf einer nachträglichen Reflexion, wie sie die praktische Philosophie Kants gibt.
- Kant spricht vom „Bedürfnis der Vernunft, vom Bedingten zum Unbedingten aufzusteigen“ (Akademie-Ausgabe Bd. 6, A 197).
- Paulus, Röm 12,21.
- Kant, RGV, B 3–64.
- J. Habermas, Vernünftige Freiheit [Auch eine Geschichte der Philosophie Bd. 2], Berlin 2019, 328.
- Ebd., 329.
- Ebd., 330 zit. Kant.
Prof. Dr. Hans Martin Dober ist ein evangelischer Theologe.
Von 1978 bis 1985 studierte Dober evangelische Theologie und Philosophie in Göttingen, Tübingen, Jerusalem und Heidelberg. Nach der Promotion 1989 in Philosophie war er bis 1994 Vikar und Pfarrvikar der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Von 1994 bis 2002 war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Praktische Theologie I (Volker Drehsen). Seit 2003 ist er Pfarrer der evangelischen Landeskirche an der Versöhnungskirche Tuttlingen. Seit 2008 lehrt er als außerplanmäßiger Professor für Praktische Theologie.