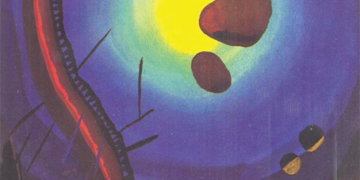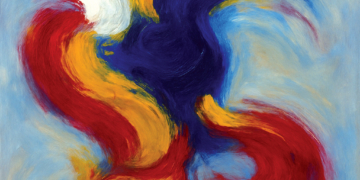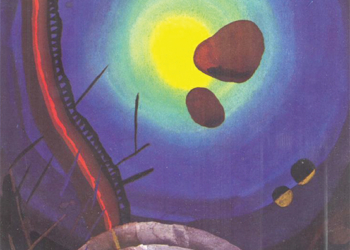Wenn wir uns anläßlich eines Jubiläums wie des 300. Geburtstages Immanuel Kants mit dessen Philosophie befassen, fragt es sich, ob unser vorrangiges Interesse philosophiehistorisch ist oder ob wir von anderen Bedürfnissen bestimmt sind wie einer systematischen Auswertung bestimmter Ergebnisse Kants oder einer Neuverortung seiner Position im Rahmen einer z.B. postkolonial motivierten Auswertung des philosophischen Theoriebestands insgesamt.
Nun ist Philosophiegeschichte, wie schon Wilhelm Windelband wußte, immer eine Mischung aus „historisch-philologischer“ und „philosophisch-kritischer“ Arbeit (Windelband, 13ff.). Doch wie sind hier die Gewichte verteilt? Ist es, gerade angesichts der Vielfalt vorliegender Re- und Dekonstruktionen, nicht vielleicht ausreichend, sich auf die Aktualisierung bestimmter philosophischer Positionen Kants zu beschränken? Und passt dies nicht sogar gut zu Windelbands Vorstellung, sofern dieser unter der Rubrik „philosophisch-kritische Arbeit“ neben formallogischen Aspekten vor allem die intellektuelle Fruchtbarkeit der rezipierten Theorie verstanden und das philosophisch Gleichgültige über Bord geworfen wissen wollte?
Nur: wer bestimmt das? Es ist offensichtlich, dass der bloße Verweis auf solide philologische Arbeit (also eine überzeugende Textrekonstruktion) das Problem der deutenden Aneignung des Gegenstandes nicht löst, sondern nur verschiebt, worauf Jens Eisfeldt vor ein paar Jahren prägnant hingewiesen hat:
„Das Aktualisierungsziel [auch, möchten man einfügen; UV] der philosophiehistorischen Analyse bestimmt der Interpret, dessen philosophische Grundhaltung im Wege einer selektiven Rezeption der kulturellen Tradition ungehindert die Ergebnisse der historischen Untersuchung beeinflussen kann. Die herkömmliche philosophiehistorische Literatur darf daher nicht – oder zumindest nicht ohne Weiteres – als historisch verlässliche Quellenanalyse aufgefasst werden.“ (Eisfeldt 2021, 348)
Auch eine philosophiehistorisch reflektierte Position und ein historisch-philologisch solides Vorgehen liefern somit keine Folie, die einen gleichsam objektiven Hintergrund für darauf zu projizierende Deutungen abliefern könnte. Sie führen vielmehr selbst unvermeidlicherweise zu deutend gefärbten Aktualisierungen des rezipierten Inhalts, wenn sie dies nicht schon (z.B. in der Wahl des Zugriffs auf den Gegenstand) von Anfang an bewußt oder unbewußt getan haben: vielleicht eine Trivialität, die man aber besser noch einmal zur Kenntnis nimmt.
Was ich nachfolgend anzubieten habe, steht selbstverständlich genau unter diesem Vorbehalt. Es ist dabei nicht mehr als ein kleiner Hinweis auf einige Aspekte der Kantischen Überlegungen zu Krieg und Frieden und deren Verortung in seinem Blick auf Geschichte, sofern diese philosophisch be- oder geschrieben werden soll, wobei der Fokus natürlich auf dem Garantie-Gedanken liegt, den der Erste Zusatz formuliert. Dass ich an manchen Stellen gerade hier und heute die sprichwörtlichen Eulen nach Athen trage, ist kaum zu vermeiden – ich hoffe, Sie durch meine Diskussionsangebote am Ende dafür entschädigen zu können.
2. Geschichtsphilosophie
„Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit – ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.” Das ist Hegel, in der Einleitung zur Philosophie der Weltgeschichte (MM 12, 32). „Eine Kritik der historischen Vernunft“, so Otfried Höffe, „hat sich Kant nie vorgenommen“ (Höffe, KA 46, IX). Doch aber ist sein geschichtsphilosophisches Denken ebenfalls das „einer Fortschrittsgeschichte der Freiheit“ (ebd., 16).
Wenn es nun um Klärung dessen geht, was Geschichte, Krieg und Frieden mit „Natur“ zu tun haben, soll zunächst ein ganz kurzer Blick auf den ersten Teil der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht geworfen werden, bevor es dann um den Ersten Zusatz der Friedensschrift gehen wird.
So enthalten die ersten beiden grundlegenden Sätze der Idee schon die Perspektive auf Geschichte als eine Naturteleologie i.S. eines regulativen Prinzips (Entwicklung der individuellen und Gattungsanlagen des Menschen). Nachfolgend wird bekanntlich davon geredet, dass die Natur es gewollt habe, dass der Mensch alles, was ihn als nicht heteronom bestimmtes Wesen auszeichnet, „aus sich selbst herausbringe“, somit Glückseligkeit und Vollkommenheit, so sie ihm zukomme, sich „durch eigene Vernunft“ (beide AA VIII, 19) verschafft habe: dies nicht aufgrund irgendeiner philanthropen Grundhaltung, sondern aufgrund des Antagonismus der Menschen in der Gesellschaft (ungesellige Geselligkeit, vgl. ebd. 20), der ihn dazu antreibe.
Dass die in einer „allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft“ (ebd. 22) zu realisierende „moralische Geselligkeit“ (Jane Kneller, KA 46, 61) dann nicht das Ende aller Dinge ist, sondern nur auf den analog zur innergesellschaftlichen Ungeselligkeit beschriebenen zwischenstaatlichen Antagonismus verweist und insoweit von dessen Regulierung abhängig ist, eröffnet hier den Raum, in den auch die Friedensschrift dann vordringt.
3. Die Friedensschrift, Erster Zusatz: Natur, Krieg, Frieden – welche Garantie worauf?
Der Erste Zusatz hebt mit einer langen Passage an, die, mit einer noch längeren Anmerkung versehen, klar machen soll, dass „die große Künstlerin Natur“ (ZeF 72) bei den Menschen Eintracht aus Zwietracht entstehen lässt, was Schicksal oder Vorsehung genannt wird (vgl. ebd.) eigentlich aber eine Art Weisheit bezeichne, die wir zwar nicht erkennen oder auf sie schließen, die wir aber den „Kunstanstalten der Natur“ (ZeF 73) hinzudenken „können und müssen“ (ebd. 74). Hinter ihrem Rücken, im Verfolgen ihrer eigenen selbstsüchtigen Interessen realisieren die Menschen genau jene Verhältnisse, die es allererst ermöglichen, den desaströsen Konsequenzen jener Interessenkonflikte (seien sie inner- oder intergesellschaftlich) zu entgehen bzw. sie zu vermeiden.
Die Frage nicht nur nach der Möglichkeit eines ewigen Friedens, sondern nach dessen objektiver Realität ist für Kant dabei so zentral, dass er ihr den Ersten Zusatz widmet, um dem Gedanken von einer Garantie für einen ewigen Frieden angemessen Raum zu geben: „durch den Mechanism in den menschlichen Neigungen selbst“, so Kant dort, soll gewährleistet werden, was theoretisch nicht absehbar, aber praktisch realisierbar sei – es soll als unsere Pflicht erwiesen werden, „zu diesem (…) Zwecke hinzuarbeiten“ (ZeF 81). Wie viel dies trägt, könnte auch unsere Frage hier werden.
Pierre Laberge unterscheidet in seinem Kommentar zum Ersten Zusatz eine Garantie im weiteren von einer im strengen Sinne. Er differenziert zwischen dem, was durch die Natur gewährleistet wird und dem, wie dies geschieht: am Ende geht es zunächst (was) um die Beschreibung der Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit – Bewohnen der gesamten (begrenzten) Erdoberfläche, Ausbreitung aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen, Regelungsbedarf der diesen zugrundeliegenden Konflikte, die unter der Rubrik Staats-, Völker- und weltbürgerliches Recht betrachtet werden. Die der Natur bei der Ausbreitung der Menschen über den gesamten Globus zugeschriebene Zweckmäßigkeit versucht Laberge zu plausibilisieren, indem er darauf verweist, dass ohne diese Annahme die Möglichkeit bliebe, sich aus dem Weg gehen, damit den Antagonismus auf allen Ebenen vermeiden zu können, was am Ende den Fortschritt zum ewigen Frieden unmöglich machte (vgl. Laberge, KA 1, 109-113). Die Frage danach, ob oder inwiefern Kants Rede davon, dass der Krieg selbst „keines besonderen Bewegungsgrundes“ (ZeF 77) bedürfe, da er „auf die menschliche Natur gepropft“ (ebd.) zu sein scheine, für uns jenseits ihrer Funktion im hier betrachteten Kontext überzeugend sein kann, bleibt dabei freilich offen.
Im strengen Sinne (wie) geschieht die Gewährleistung der Natur Laberge zufolge nun dadurch, dass sie sich mehrerer Mittel bedient, die sämtlich der Diversität menschlichen Daseins entspringen und ein dreifaches Ziel verfolgen: sie sollen zur Herstellung einer republikanischen Verfassung (1. Staatsrecht), zu einem Föderalismus freier Staaten (2. Völkerrecht) und schließlich zu einem Weltbürgerrecht (3.) führen. Mittel ist zum einen (wenig überraschend) der Krieg, und zwar innerlich wie äußerlich. Es reicht (ad 1.) hier eine rational-egoistische Motivation zur Errichtung eines republikanisch verfassten Gemeinwesens zum Schutz im Inneren wie auch gegen andere Staaten anzunehmen (Volk-von-Teufeln-Argument; vgl. ZeF 78f.). Sodann nennt Kant (ad 2.) die „Verschiedenheit der Sprachen und Religionen“ (ebd. 80f.), die neben dem „wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege“ (ebd.) jedoch bei „anwachsender Kultur“ und weiterer Annäherung der Menschen auch das Potential zu „größerer Einstimmung in Prinzipien, zum Einverständnisse in einem Frieden“ (ebd., 81) in sich tragen, der nicht despotisch ist. Schließlich befördere (ad 3.) der Handelsgeist einerseits die individuellen, divergierenden Interessen, könne andererseits aber „mit dem Kriege nicht zusammen bestehen“ (ebd., 83).
Weil der Erste Zusatz hier wenig sagt, unternimmt Laberge im Folgenden einige Anstrengungen, um unter Rekurs auf andere geschichtsphilosophische Schriften Kants zu klären, wie und zu welchem Preis der äußere Krieg die Republikanisierung des Staates befördert. Wichtig scheint mir hier zu sein, dass Laberge dabei auf offene Fragen verweist, die uns auch heute noch interessieren sollten: wie ist der Kantische Hinweis auf die Diversität von Sprachen und Religionen im Zusammenhang ihrer Funktion (wenn man das so sagen darf) im Prozeß der fortschreitenden Realisierung von Freiheit zu verstehen? Welcher Kontexte bedarf es – Laberge weist hier auf Rousseaus Überlegungen zum Ursprung der Verschiedenheit der Sprachen hin -, um diese Rede in ihren beiden Dimensionen (Hass und Krieg/Annäherung und Einstimmung in Prinzipien) zu verstehen? Und, könnte man, bei Rousseau bleibend, nahtlos weiterfragen, wären auch zum Thema „Handelsgeist“ und „Geldmacht“ (vgl. 81) nicht geschichts- oder sozialphilosophische Überlegungen hilfreich, die einen Zusammenhang zur ökonomisch-sozialen Entwicklung der Menschheit herstellen helfen, wie wir das im Artikel „Economie politique“ finden?
Auch Otfried Höffe thematisiert am Ende seines Artikels zum Ersten Zusatz unter dem Titel „Epistemischer Status“ die Frage danach, wie belastbar (und, so möchte ich ergänzen, in der Folge zukunftsfähig) die Kantischen Überlegungen hinsichtlich der Garantie eines ewigen Friedens sind (vgl. KA 46, 172f.) Dabei weist er völlig zurecht darauf hin, dass der von Kant beschriebene „Mechanismus der menschlichen Neigungen“ nicht im Sinne eines harten Kausalnexus mißverstanden werden darf. Was der an die Stelle einer solchen, Sicherheit verheißenden Instanz tretende Verweis darauf, dass dies in praktischer Absicht genug sei, um auf das Ziel eines ewigen Friedens legitimerweise hinzuarbeiten, aber wert ist (also trägt), hatte ich schon eingangs gefragt. Höffes problemorientierte Antwort konstatiert hier eine bleibende Spannung zwischen dem Menschen als Subjekt der Geschichte (also als zum Reich der Freiheit gehörig) und ihm als ihr Objekt, sofern er als Naturwesen seinen selbstsüchtigen Neigungen unterworfen bleibt: was ja die Grundannahme war, die uns über den angeführten Antagonismus und Krieg in der Geschichte überhaupt zum ewigen Frieden trieb und uns zu entsprechendem Handeln verpflichtete (vgl. ebd.).
Auch wenn dies am Ende nicht wirklich überzeugt und wenn die „Erklärung“ und Funktion, die Kant dem Krieg zuschreibt, uns heute nicht als ausreichend erscheinen mag (wie Vieles, was geschichtsphilosophisch formuliert wurde) und sein geschichtsphilosophischer Optimismus (wenn man das so sagen kann) am Anfang des 21. Jahrhunderts sicher brüchiger erscheinen mag als am Ende des 18. Jahrhunderts, bleibt zu vermuten, dass es ohne einen geschichtsphilosophischen Überhang, der die poltisch-historischen Analysen des globalen konflikthaften Mit- und Gegeneinanders rahmt und eben auch nicht mehr als „Hoffnung“ ausdrückt, kaum gehen wird: ob Kants Überlegungen uns dabei nun helfen oder nicht.
4. Schluß: was tun wir eigentlich heute, wenn wir Kant lesen?
Vielleicht kann man das am Ende einigermaßen allgemein so sagen: wir schauen philosophiehistorisch informiert auf mögliche Beiträge zu heutigen Problemen und Diskussion. Gut daran ist, dass Menge und Vielfalt der philosophiehistorischen Arbeiten zu eigentlich allen Teilen der Kantischen Theorie uns dazu befähigen, unsere jeweiligen Deutungen auf einer sicheren Basis vorzunehmen – ich habe zu meiner kleinen Frage nur zwei unterschiedliche Lesarten der Garantie angeführt, die je auf ihre Art wohlwollend die Kantische Argumentation als zwar problematisch, aber stützbar (so lese ich Laberge) bzw. nicht inkonsistent (so Höffe) begreifen und sie damit im Spiel lassen.
Und genau darum muß es in meinen Augen heute gehen, wenn wir uns historischer Positionen der Philosophie versichern: nicht um einfache Anwendung oder Übertragung auf unsere Welt- oder Diskussionslagen, sondern (im Windelbandschen Sinne) um die Feststellung, worin die intellektuelle Fruchtbarkeit der rezipierten Theorie besteht und was von ihr zu verwerfen ist. Dass diese Klärung eine Frage unseres je unterschiedlichen Interesses (in jeder möglichen Hinsicht), damit Ausdruck unserer diversen Zugänge und Ausgangsverständnisse ist, muss uns dabei immer klar sein und muss auch klar gemacht werden: damit am Ende geklärt werden kann, was in einer Rezeption wie aufzunehmen und was zurückzuweisen ist. Wir müssten am Ende dazu bereit sein, uns darüber zu verständigen, was wir für intellektuell fruchtbar halten. Und wir müßten diese dann hoffentlich gewonnene Einsicht verteidigen.
Quellen:
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. – In: Ders.: Werke. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe. Redaktion: Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Bd. 12. Frankfurt/M. 1986. [MM]
- Kant, Immanuel: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis / Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Mit Einleitung und Anmerkungen, Bibliographie und Register kritisch herausgegeben von Heiner F. Klemme. Hamburg 1992 [ZeF darin 49-103].
- Kant, Immanuel: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. – In: Kants Werke. Akademie-Textausgabe. Bd. VIII. Berlin 1968,15-32.
- Kant, Immanuel: Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte. – In: Kants Werke. Akademie-Textausgabe. Bd. VIII. Berlin 1968, 107-124.
Kommentare
- Kant, Immanuel: Schriften zur Geschichtsphilosophie. Klassiker Auslegen [KA]. Bd. 46. Hrsg. von Otfried Höffe. Berlin 2011.
- Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Klassiker Auslegen [KA]. Bd. 1. Hrsg. Von Otfried Höffe. 3. Auflage Berlin 2011.
Sekundärliteratur
- Eisfeld, Jens: Methodische Überlegungen zur Philosophiegeschichte am Beispiel der Kant-Rezeption. – In: Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre: Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie. Hrsg. v. Diethelm Klippel, Dieter Hüning und Jens Eisfeld. Berlin, Boston 2021, 317-354.
- Höffe, Otfried: Vorwort. – In: KA 46, IX.
- Höffe, Otfried: Einleitung. – In: KA 46, 1-27.
- Höffe, Otfried: Zum ewigen Frieden, Erster Zusatz. – In: KA 46, 157-174.
- Kneller, Jane: „Nur ein Gedanke“. Ein Kommentar zum Dritten und Vierten Satz von Kants Idee. – In: KA 46, 45-62.
- Laberge, Pierre: Von der Garantie des ewigen Friedens. – In: KA 1, 107-121.
- Windelband, Wilhelm: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Hrsg.v. Heinz Heimsoeth, 13. Aufl. Tübingen1980.
Ulrich Vogel
Geboren 1963, studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie in Marburg. 1992 promovierte er mit einer Arbeit über die Frühphilosophie Schellings. Bis 2004 war er Mitherausgeber einer zweisprachigen (deutsch-russischen) Ausgabe ausgewählter Schriften Immanuel Kants. Seit 2004 ist er verantwortlich für die Konzeption und Durchführung der fachdidaktischen Studienanteile der Unterrichtsfächer Ethik und Philosophie im Studiengang Lehramt an Gymnasien. Dr. Vogel hat Publikationen zu Kant und dem Deutschen Idealismus sowie zu fachdidaktischen Fragen, insbesondere an der Schnittstelle der Fächer Ethik/Philosophie und Religion, veröffentlicht