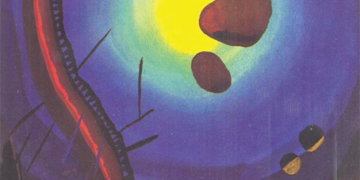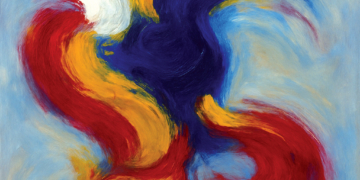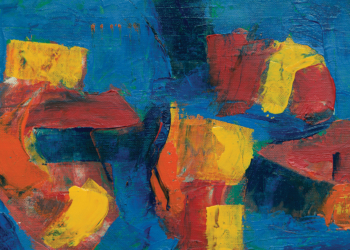Was veranlasst Philosophen und Geisteswissenschaftlern heute, sich mit einem deutschen Philosophen des 18. Jahrhunderts zu beschäftigen? Was motiviert uns, uns den drängenden Fragen der Gegenwart im Ausgang von Kant zu widmen?
Kurz gesagt: Was macht Kant heute relevant – nicht nur in einem europäischen Kontext, in dem sich Populismus und Rassismus ausbreiten sowie die extreme Rechte droht, das Schicksal Europas in die Hand zu nehmen, sondern ebenfalls in einem arabischen Kontext, der von Ideologien beherrscht wird, die der Moderne, dem Kosmopolitismus und der Werten der Aufklärung feindlich gegenüberstehen? Diese Fragen setzen eine bestimmte Lesart von Kants philosophischem Erbe voraus – eine, die mit der Frage nach der Gegenwart verknüpft ist.
In seinem Kommentar zu Kants Text Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? schreibt Michel Foucault, dass die Frage, die in Kants Text als Erstes auftaucht, jene nach der Gegenwart ist.1 Natürlich wäre es leicht, Foucault zu widersprechen, und ebenso weisen viele Kant-Kommentatoren darauf hin, dass für Kant in seiner Philosophie die praktische Vernunft Vorrang hat. Otfried Höffe zufolge „billigt [Kant] der Vernunftkritik einen mehr als nur innerakademischen, einen öffentlichen Wert zu“.2 Vielleicht ist es nicht übertrieben, Kants Philosophie als ein Buch über Erziehung zu lesen, insbesondere wenn wir uns an Rousseaus Einfluss auf ihn erinnern oder – um eine Heidegger‘sche Formel zu verwenden – sein Denken als eine „Erziehung zum Denken“ verstehen. Die gesamte Philosophie Kants lässt sich laut Reinhard Brandt in der Idee der „Bestimmung des Menschen als dessen Selbstbestimmung“ zusammenzufassen3 – eine Idee, die eng mit der Aufklärungsbewegung und ihrer Ablehnung der verschiedenen Formen der Vormundschaft verbunden ist.
Es handelt sich um eine Selbstbestimmung, die auf der Ebene des Individuums wie der Gattung zu verwirklichen sei.4
Kant drückt es in seinem Aufsatz über die Aufklärung sicherlich deutlicher aus: nämlich als die philosophische Zugehörigkeit zur Gegenwart oder die Notwendigkeit, dass sich das Denken auf die Gegenwart beziehen soll oder die Philosophie als „ein Problem der Gegenwart“ zu verstehen ist. Dies beinhaltet, in Foucaults Sprache, eine „neue Infragestellung der Moderne“ sowie eine neue Praxis der Philosophie – eine Praxis, in der die Philosophie ihre Gegenwart befragt, deren Entstehung Foucault auf das Ende des 18. Jahrhunderts festlegt. Eine Philosophie, die sich von Hegel über Nietzsche und Max Weber bis zur Frankfurter Schule – ich weiß nicht, warum Foucault in diesem Zusammenhang vergisst, Marx zu erwähnen – bis hin zu Foucault selbst äußern wird.
Kant drückt es in seinem Aufsatz über die Aufklärung deutlicher aus: als die philosophische Zugehörigkeit zur Gegenwart oder die Notwendigkeit, dass sich das Danken auf die Gegenwart beziehen soll. Dies beinhaltet in Foucaults Sprache eine ,neue Infragestellung der Moderne‘ sowie eine Praxis, in der die Philosophie ihre Gegenwart befragt.
Foucault argumentiert, dass Kant die beiden großen kritischen Traditionen begründet hat, welche die philosophische Praxis in der Moderne definieren. Die erste Tradition untersucht die Bedingungen der Möglichkeit wahrer Erkenntnis, was Foucault die „Analytik der Wahrheit“ nennt; die zweite Tradition oder das „zweite Modell des Fragens“, das Kant in seinem Text über die Aufklärung aufstellt, ist jene, die sich auf die Gegenwart bezieht, was Foucault als die „Ontologie der Gegenwart“ bezeichnet.5
Der Text, den ich hier vorstelle, steht im Kontext der zweiten Tradition und ist an eine spezifische Gegenwart gebunden, nämliche jene der heutigen arabischen Welt, und kehrt nur durch diese Gegenwart und ihre Fragen zu Kant zurück. Denn die Frage der Aufklärung, von der man eine Zeit lang glaubte, sie sei ausschließlich eine Frage des 18. Jahrhunderts, erscheint heute als eine Frage, die sich innerhalb der Moderne stets dann stellt, wenn die modernen Werte bedroht werden, ob durch „vormoderne Nostalgie“ wie im arabisch-islamischen Kontext oder durch „postmoderne Skepsis“, wie wir sie aus dem westlichen Kontext kennen.6 Selbst angesichts der neuen Formen der Bevormundung, die das kindische Ethos des Neoliberalismus hervorbringt und reproduziert, scheint die Aufklärung heute die letzte Bastion der Vernunft, der Kritik sowie der Autonomie zu sein.7
Erste These: Die Krise der modernen Welt, ist eine Krise der Erziehung. Die arabischen Sozialwissenschaften mit ihren verschiedenen Ansätzen und Disziplinen bestätigen, dass die heutigen arabischen Gesellschaften unter einer großen Erziehungskrise leiden. Diese Krise findet in allen Bereichen unterschiedliche Ausdrucksformen: Der Historiker und Denker Abdallah Laroui bringt sie mit dem Begriff der kulturellen Rückständigkeit zum Ausdruck, der uns an die Verspätete Nation Helmuth Plessners erinnert. Es handelt sich, wie er schreibt, um eine Verspätung beim Anschluss an „das liberale Zeitalter, wie es sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelte und im 19. Jahrhundert aufblühte“8, wobei er argumentiert, dass die arabische Kultur der liberalen Kultur nahezu punktuell entgegengesetzt ist. Laroui fasst das arabische Problem in dem zusammen, was er „Dualismus“ nennt, der seiner Ansicht nach sowohl eine „Tatsache“ als auch eine „Politik“ darstellt. Er spricht sogar von einer „pädagogischen Politik“, die sich in einer ständigen „Vertiefung des Dualismus“ zu politischen Zwecken verwirklicht. Sie zielt darauf ab, das politische System und dessen Eliten zu erhalten.9
Die politische Anthropologie von Abdullah Hammoudi zeigt, wie der Meister und sein Lehrling als eine sufische Form der Erziehung und Indoktrination über die sufischen Strukturen hinausgehen und den Modus Operandi der Machtbeziehungen und politischen Institutionen im arabischen Kontext bilden.
Die Krise der modernen Welt, ist eine Krise der Erziehung. Die arabischen Sozialwissenschaften mit ihren verschiedenen Ansätzen und Disziplinen bestätigen, dass die heutigen arabischen Gesellschaften unter einer großen Erziehungskrise leiden.
Die zentrale Frage in seinem anthropologischen Werk lautet: „Wie können wir die Ausbreitung autoritärer politischer Systeme in unseren Gesellschaften vom Ozean bis zum Golf erklären?“10 So sind die verschiedenen Arbeiten von Politikwissenschaftlern, die versucht haben, das Fortbestehen des Autoritarismus in der arabischen Welt mit ausschließlich politischen Begriffen zu erklären, gescheitert. Die Entwicklungen nach dem sogenannten Arabischen Frühling bilden einen deutlichen Beweis dafür, dass die Reduzierung des Autoritarismus auf dessen politische Dimension eher seine Symptome als seine Ursachen erklärt, die, wie Hammoudi bereits vor Jahrzehnten feststellte, auch religiös-kultureller Natur sind. Daher muss eine Kritik der herrschenden Politik auch eine Kritik der herrschenden Kultur oder des herrschenden kulturellen Paradigmas und Wertesystems sein, das diese Politik formt, ihr dient, sie legitimiert sowie reproduziert. In Hammoudis Sprache geht es um „eine Art von Regeln, die die alltägliche Interaktion bestimmen und die Reproduktion bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse sicherstellen“.11 In diesem geschlossenen System ist politische Partizipation ausschließlich im Rahmen von Gehorsam möglich.
Hisham Sharabi bietet mit seinem Konzept des Neo-Patriarchats eine überzeugende Erklärung für die Realität der zeitgenössischen arabischen Gesellschaften und der Strukturen und Beziehungen, die sie bestimmen. Dieses Konzept spricht von einer sozialen Ordnung, die Modernität und Patriarchat miteinander verbindet sowie zu einer Gesellschaft führt, die von Gruppen wie sektiererischen, stammesbezogenen, ethnischen oder religiösen Bewegungen dominiert wird.12 In dieser Gesellschaftsordnung werden die Moderne sowie deren technischen Errungenschaften genutzt, um die herrschenden Strukturen und Hierarchien zu reproduzieren. Oder, um es genauer zu formulieren: Wir haben es mit einer Gesellschaftsordnung zu tun, welche die Modernisierung ohne Modernität lebt; das heißt getrennt von ihren erkenntnistheoretischen, politischen und menschenrechtlichen Werten.
Diese und viele andere Beiträge, etwa von arabischen Feministinnen, zeigen zweifelsfrei, dass es sich bei der Krise der arabischen Gesellschaften heute um eine Krise der Erziehung handelt und dass sich diese Krise vor allem, um es mit Kants Worten zu sagen, in der Erziehung durch „Väter“ und „Fürsten“ ausdrückt.13 Es handelt sich um eine egoistische und kurzsichtige Erziehung seitens der Eltern, denn ihr Ziel ist eher an die Gegenwart als an die Zukunft gebunden, und es ist eine instrumentelle Erziehung seitens der Fürsten, die die Bürger zu bloßen Werkzeugen des Staates macht. Sie stellt ein Hindernis für ihre kosmopolitische Entwicklung, für ihre Zugehörigkeit zur Welt dar.
Hisham Sharabi bietet mit seinem Konzept des Neo-Patriarchats eine überzeugende Erklärung für die Realität der zeitgenössischen arabischen Gesellschaften und der Strukturen und Beziehungen, die sie bestimmen. Dieses Konzept spricht von einer sozialen Ordnung, die Modernität und Patriarchat miteinander verbindet sowie zu einer Gesellschaft führt, die von Gruppen wie sektiererischen, stammesbezogenen, ethnischen oder religiösen Bewegungen dominiert wird.
Zweite These: Die kantische Konzeption der kosmopolitischen Erziehung bietet einen wesentlichen Ansatzpunkt, um die Krise der zeitgenössischen arabischen Gesellschaften und ihrer Erziehungssysteme zu verstehen. Die kosmopolitische Erziehung, wie Kant sie versteht, widerspricht der autoritären Erziehung, welche die vorherrschenden sozialen und politischen Strukturen und Verhältnisse hervorbringt und reproduziert. Erstens, weil sie von einem Weltbürger oder einer Zugehörigkeit zur Welt spricht, die über enge nationale, religiöse und sektiererische Zugehörigkeiten hinausgeht, die auf Herrschaft beruhen und der individuellen Freiheit im Wege stehen – eine Zugehörigkeit, die als Erziehung zur Menschlichkeit zu verstehen sei, und nicht wie die instrumentelle Erziehung, die in der Familie und Gesellschaft des Neo-Patriarchats vorherrscht. Zweitens ist sie eine Erziehung zur Zukunft. So schreibt Kant: „Ein Prinzip der Erziehungskunst, das besonders solche Männer, die Pläne zur Erziehung machen, vor Augen haben sollten, ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftigen möglichen besseren Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit, und deren ganzer Bestimmung angemessen, erzogen werden. Dieses Prinzip ist von großer Wichtigkeit. Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder nur so, dass sie in die gegenwärtige Welt, sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde.“14 Es handelt sich weder um eine passeistische Erziehung, die auf einen Imitatio Muhammadi beruht – das heißt ein vergangenes Modell wiederherstellen will –, noch um eine Erziehung, die mit dem Status quo versöhnt ist. Drittens ist es eine Erziehung, die auf Mündigkeit abzielt: Sie möchte keine Untertanen, sondern autonome Bürger zur Welt bringen. Die Aufgabe des Staates besteht laut Kant darin, das Recht der Menschen auf Freiheit zu schützen. „Jeder Eingriff des Staates, der darauf zielt, das Wohlergehen oder die Moralität seiner Bürger auf Kosten ihrer Freiheit zu befördern – in der Annahme, dass diese sich in einer Situation der Unmündigkeit befänden, und sich widerrechtlich ihren Schutz anmaßten – ist für Kant rechtlich null und nichtig.“15 John Stuart Mill würde die gleiche Position wie Kant einnehmen, indem er Paternalismus als eine Form der Tyrannei versteht und argumentiert, dass „die einzige Freiheit, die diesen Namen verdient, die Freiheit ist, unser eigenes Wohl auf unsere eigene Weise zu verfolgen, solange wir nicht versuchen, andere ihres Wohls zu berauben oder ihre Bemühungen, es zu erlangen, zu behindern“.16
Die Beziehung zwischen Erziehung sowie Demokratie ist zweifellos eine dringende Frage unserer Zeit und die Arbeit am Aufbau einer demokratischen Persönlichkeit das Ziel jeder Erziehung, die sich ihrer Rolle in der heutigen Welt bewusst ist. Kants Philosophie bleibt eine wesentliche Quelle für Überlegungen zu diesem Thema – selbst für diejenigen, die seinen ethischen Entwurf in ihren Erziehungsphilosophien kritisiert haben, wie John Dewey oder Hannah Arendt, weil er angeblich die soziale Identität des Individuums vernachlässigt17.
Dritte These: Der Vorwurf, kosmopolitische Erziehung sei abstrakt oder ignoriere die kulturellen Besonderheiten des Einzelnen, ist derselbe Vorwurf, der gegen die universellen Menschenrechte erhoben wird, um eine autoritäre Politik zu verteidigen und zu legitimieren. Der Partikularismus beraubt die lokalen Kulturen des Rechts auf Entwicklung und bindet sie an ein endgültiges und geschlossenes Modell. Im arabischen Kontext vertritt die herrschende Kultur einen ahistorischen Partikularismus, der auf einer verzauberten Beziehung zur Vergangenheit beruht sowie die Bürger in einem Zustand der Unmündigkeit hält oder den Paternalismus fortsetzt. Die Bürger haben kein Recht auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Erbe, da es sich gemäß dieser Auffassung um ein sakrales Erbe handelt. Die Logik der Aufklärung ist eine andere. Dazu schreibt Susan Neiman: „Eine erwachsene Beziehung zur Kultur unterscheidet sich nicht von einer erwachsenen Beziehung zu den eigenen Eltern. Man muss entscheiden, welche Teile des Erbes sich zu eigen machen will, aber zuerst muss man es sich ansehen.“18
Dritte These: Der Vorwurf, kosmopolitische Erziehung sei abstrakt oder ignoriere die kulturellen Besonderheiten des Einzelnen, ist derselbe Vorwurf, der gegen die universellen Menschenrechte erhoben wird, um eine autoritäre Politik zu verteidigen und zu legitimieren. Der Partikularismus beraubt die lokalen Kulturen des Rechts auf Entwicklung und bindet sie an ein endgültiges und geschlossenes Modell.
Die Zugehörigkeit zu kosmopolitischen Werten würde den lokalen Kulturen dienen und sie nicht nur dazu ermutigen, den Anschluss an das internationale kosmopolitische Recht zu finden, sondern zudem ihre Institutionen in Übereinstimmung mit diesem Recht zu demokratisieren. Der Kosmopolitismus ermutigt den Einzelnen, neue Beziehungen zu seiner eigenen Kultur und Gesellschaft zu entwickeln, die nicht auf Unterwürfigkeit, engem Nationalstolz oder gar Rassismus gegenüber anderen Kulturen beruhen. Die Beziehung zum Anderen formt das Selbst und definiert dessen moralische Identität. Deswegen steht die kosmopolitische Erziehung im Gegensatz zum Okzidentalismus und zum Neo-Okzidentalismus, den wir heute im Denken der Dekolonialität begegnen. Ja, mögen manche einwenden, aber der Kosmopolitismus kennt keine immanente Solidarität – eine, die aus Fleisch und Blut besteht. Er bleibt der Ausdruck einer abstrakten Zugehörigkeit. Das Gegenteil ist der Fall: Solidarität und Zugehörigkeit sind nicht einerlei. Habermas’ Urteil über die deutsche Kultur gilt im Grunde für sämtliche Kulturen, die in der Moderne und ihrer nationalistischen Logik verhaftet sind: Sie haben die Möglichkeit verloren, ihre politische Identität auf etwas anderem als universalistischen bürgerlichen Prinzipien und Menschenrechten zu gründen, und können mit ihren nationalen Traditionen nur noch in Form von Kritik und Selbstkritik umgehen.19
Die Logik der unbedingten Zugehörigkeit ist mit der kritischen Vernunft unvereinbar und ähnelt der Position der dogmatischen Vernunft innerhalb der Metaphysik. Die Aufgabe der Erziehung ist es, den Mangel der Natur zu kompensieren, aber in der zeitgenössischen arabischen Situation muss sie einen doppelten Mangel kompensieren: nämlich jenen, den Kant als natürlichen Mangel bezeichnete, aber auch jenen, den man als zivilisatorischen Mangel bezeichnen kann, der die Fortsetzung eines verlorenen Kampfes zwischen Kultur und Zivilisation im arabischen Kontext ist. Gemäß Höffe strebt Kants kosmopolitische Erziehung die Aufklärung an.20 Hier stellt sich die Frage nach der Religion in großem Umfang – ein Thema, das auch Kant und seine Zeit beschäftigen wird. Und Kant bietet dazu Überlegungen an, über die es sich lohnt, nachzudenken, und von denen man lernen kann, vor allem auf der Grundlage seiner Konzeption der Vernunft als Friedensstifterin.
Vierte These: Für Kant ist das Endziel der Vernunft und des rationalen Denkens der Frieden. Die Überlegungen zum Weltbürgertum, zur kosmopolitischen Gastfreundschaft und zum Kosmopolitismus werden im Allgemeinen auf Kant und dessen Idee des ewigen Friedens zurückgeführt, auch wenn manche es mitunter vorziehen, auf die stoische Philosophie zurückzugreifen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber zunächst die Aufgabe, die Kant der Vernunft oder der Kritik der Vernunft zuschreibt, die für ihn die Verwirklichung des Friedens ist. Kant versteht die durch Kritik und Selbstkritik definierte Vernunft in einem metaphysischen und politischen Sinne als Garant für den ewigen Frieden. Dies bringt er in seiner Kritik der reinen Vernunft präzise und inbrünstig zum Ausdruck. Wenn Kant von dieser „diplomatischen“ Mission der Vernunft spricht, verknüpft er sie mit zwei wesentlichen Bedingungen: „Kritik“ und „Freiheit“.
Vierte These: Für Kant ist das Endziel der Vernunft und des rationalen Denkens der Frieden. Die Überlegungen zum Weltbürgertum, zur kosmopolitischen Gastfreundschaft und zum Kosmopolitismus werden im Allgemeinen auf Kant und dessen Idee des ewigen Friedens zurückgeführt, auch wenn manche es mitunter vorziehen, auf die stoische Philosophie zurückzugreifen.
Die Vernunft kann ihre Aufgabe lediglich dann vollständig erfüllen, wenn sie der Kritik unterworfen ist. Und die Kritik kann nur in der Freiheit verwirklicht werden, denn Freiheit bedeutet, dass jede Idee und jede Autorität der Kritik unterworfen ist. Dazu schreibt Kant: „Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern deren Anspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, denen jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein Veto ohne Zurückhalten muss äußern können.“21 Im Rahmen seiner Kritik an der dogmatischen Position spricht Kant von der Vernunft als einem Gericht, das ausschließlich in einem Kontext der Freiheit rational arbeiten kann und in dessen Arbeit keine „fremden Hände“ eingreifen, „um sie wieder ihren natürlichen Gang nach erzwungenen Absichten zu lenken“.22 Klarer ausgedrückt: „Lasset demnach euren Gegner nur Vernunft sagen, und bekämpft ihn bloß mit Waffen der Vernunft.“23 Die Waffe der Vernunft ist Kant zu Folge die Kritik, nicht die Großsprecherei. Wie er schreibt: „Ohne dieselbe ist die Vernunft gleichsam im Stande der Natur, und kann ihre Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen oder sichern als durch Krieg. Die Kritik dagegen, welche alle Entscheidungen aus den Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung nimmt, deren Ansehen keiner bezweifeln kann, verschafft uns die Ruhe eines gesetzlichen Zustandes, in welchem wir unsere Streitigkeiten nicht anders führen sollen als durch Prozess. Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sich beide Teile rühmen, auf den mehrteils ein nur unsicherer Friede folgt, den die Obrigkeit stiftet, welche sich ins Mittel legt, im zweiten aber die Sentenz, die, weil sie hier die Quelle der Streitigkeiten selbst trifft, einen ewigen Frieden gewähren muss.“24 So fasst Kant die Entwicklung der Philosophie des Geistes in der Geschichte in drei zentralen Begriffen zusammen: Dogmatismus, Skeptizismus und schließlich Kritik oder Kritizismus. Der Dogmatismus bezeichnet die Selbstüberschätzung der Vernunft und bedeutet den Glauben, dass die philosophische Vernunft die Dinge a priori erkennen kann. Das zweite Moment der Skepsis beruht für Kant auf der Vorstellung, dass alle Metaphysik unmöglich ist. Das dritte Moment, das kantische Moment, ist das Moment der Kritik der reinen Vernunft oder das Moment der Selbstkritik der Vernunft, das den ständigen Konflikt in der Metaphysik beendet und den Weg zum Frieden in ihr ebnet. Deshalb stellt das dritte Moment in Kants Sprache auch eine Art Gericht dar. Es ist ein Gericht oder ein Prozess, der letztlich den ewigen Frieden garantieren soll. Die Lösung dieses Konflikts, die Kritik und Selbstkritik erfordert, bildet ein zentrales Merkmal der gesamten Philosophie Kants, nicht nur seiner Metaphysik. Die Kritik ist sogar wichtiger als der Frieden selbst, wie Hans Saner erläutert: „Der Weg zum Frieden, sei es nun der in der Metaphysik oder der in der Politik, ist Kant wichtiger als der Friede selber. Ja dieser Friede hat überhaupt nur solange Sinn, als er einen Weg öffnet und ihn ausrichtet, also nur solange, als er nicht erreicht ist. Das ist Paradox. (…) Der Friede ist also nicht Selbstzweck. Kant strebt die Einheit nicht bedingungslos an. Wünschenswert ist deshalb nicht irgendein Weg zu ihr, sondern ein bestimmter, ausgezeichneter: der Weg der Aufklärung.“25
Die Kritik ist sogar wichtiger als der Frieden selbst, wie Hans Saner erläutert: „Der Weg zum Frieden, sei es nun der in der Metaphysik oder der in der Politik, ist Kant wichtiger als der Friede selber. Ja dieser Friede hat überhaupt nur solange Sinn, als er einen Weg öffnet und ihn ausrichtet, also nur solange, als er nicht erreicht ist.
Es ist ein Frieden, der auf dem Prinzip der kritischen Vernunft beruht, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Jeder Frieden, der sein Schicksal nicht an die Vernunft bindet, bleibt ein falscher Frieden, und jeder Frieden, der nicht in Freiheit und Ehrlichkeit verwirklicht wird, bleibt ein falscher Frieden, sowohl inner- als auch außerhalb der Metaphysik. Wie Saner schreibt: „Der politische Friede beginnt damit, dass man die Dinge als das bezeichnet, was sie sind. Das Prinzip der Lüge ist das Prinzip des Krieges. (…) das ist die radikale Absage an die Geheimdiplomatie, an die Schlauheit als letzte Freistätte der Staatsräson, kurzum: an die Politik der Unwahrhaftigkeit.“26 Aus diesem Grund verteidigt Kant auch die Rechtsstaatlichkeit inner- und außerhalb des Staates. Der Frieden ist das höchste Gut. Ausschließlich die kritische Vernunft ist in der Lage, den Frieden in Theorie und Praxis zu verwirklichen. Hans Michael Baumgarten schreibt: „Kants Philosophieren im Ganzen ist ein Versuch, aus der Erfahrung des Streites, des Kampfes der Philosophien ebenso wie der Individuen und Staaten, heraus zu schlichten und Frieden zu stiften.“27 Erst mit Kant wurde der Frieden zu einem zentralen Begriff in der Philosophie. Augustinus bildet eine Ausnahme in der vormodernen Philosophie, aber sein Frieden ist dem Jenseits vorbehalten. Für Kant hingegen muss der Frieden hier auf Erden nach der Idee des Rechts verwirklicht werden und ist nicht nur eine politische Taktik oder eine Ruhephase, in der die Kriegsparteien verschnaufen, um sich auf einen neuen Krieg vorzubereiten.
Fünfte These: Kant vertritt ein ethisch-demokratisches Aufklärungskonzept, das alle Menschen umfasst. Otfried Höffe betont, dass Kants Aufklärung eine ethische Dimension hat, das heißt, dass es bei der Aufklärung nicht um die Anhäufung von Wissen geht, sondern um eine moralische Pflicht, „die in nichts weniger als einer Revolution der inneren Lebenshaltung, der Einstellung zur Welt, besteht“.
Fünfte These: Kant vertritt ein ethisch-demokratisches Aufklärungskonzept, das alle Menschen umfasst. Otfried Höffe betont, dass Kants Aufklärung eine ethische Dimension hat, das heißt, dass es bei der Aufklärung nicht um die Anhäufung von Wissen geht, sondern um eine moralische Pflicht, „die in nichts weniger als einer Revolution der inneren Lebenshaltung, der Einstellung zur Welt, besteht“.28 Die Unmündigkeit, von der Kant in seinem Aufsatz über die Aufklärung und in seinem Buch Anthropologie in pragmatischer Hinsicht spricht, ist eine ethische Unmündigkeit, die aber auch eine politische Dimension aufweist. Indem Kant betont, dass sich die Aufklärung nicht auf die Anhäufung von Wissen reduziert, lehnt er andererseits die aristokratische Konzeption der Aufklärung ab, die der französischen Enzyklopädisten. Auch deshalb, und wie Höffe es beschreibt, ist die kantische Aufklärung als „die Ablehnung jeder intellektuellen Aristokratie zugunsten einer Demokratie auch in geistigen Dingen“ zu verstehen.29 Mit anderen Worten: Jeder Mensch ist fähig und qualifiziert für Aufklärung und Freiheit von Bevormundung, unabhängig von seiner Kultur, Religion, sozialen Schicht usw. Daher rührt die kosmopolitische Dimension der Aufklärung, die im Gegensatz zu vielen westlichen philosophischen Schriften steht, die bis heute Begriffe wie Sinn, Revolution, Befreiung und viele andere als exklusiv westliche verstehen.30
Sechste These: Für Kant zielt die Erziehung auf die Verwirklichung der Idee der Humanität im Menschen. Und es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Kant der einzige Philosoph der Moderne ist, der ganz und gar kosmopolitisch denkt und dem die eurozentrische Arroganz fremd geblieben ist.31 Neben seinem erkenntnistheoretischen Kosmopolitismus, der in der Kritik der reinen Vernunft zu Wort kommt, und seinem ethischen Kosmopolitismus, den Kant als die für alle Menschen geltende moralische Ordnung zum Ausdruck bringt, ist seine kosmopolitische Erziehung hier zu erwähnen, welche die Idee der Humanität im Menschen zu verwirklichen sucht. Erziehung muss kosmopolitisch gestaltet werden, wie Kant es betont.32 Und das ist genau das, was er nicht in der elterlichen oder fürstlichen Erziehung findet.
Sechste These: Für Kant zielt die Erziehung auf die Verwirklichung der Idee der Humanität im Menschen. Und es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Kant der einzige Philosoph der Moderne ist, der ganz und gar kosmopolitisch denkt und dem die eurozentrische Arroganz fremd geblieben ist.
Diese strebt nicht danach, das Beste in der Welt zu erreichen, sondern bleibt ein Gefangener der nationalen Egoismen. Kant verstand Erziehung als Disziplinierung, Kultivierung und Zivilisierung. Es handelt sich um eine, die die Kinder in ihre Zeit und in die Gesellschaft zu integrieren sucht, doch erst die moralische Erziehung verbindet sie mit der Zukunft und mit der Menschheit. Für Kant ist es keine nationalistische Erziehung, wie sie Fichte in seinen „Briefen an die deutsche Nation“ entwickelt hat – ein Buch, das großen Einfluss auf das arabische ideologische Denken von Sati’ al-Husri bis Hassan Hanafi und seine Konzeptualisierung des Okzidentalismus haben sollte –, sondern eine, wie Höffe erklärt, die nicht auf eine bestimmte Kultur oder Epoche ausgerichtet ist, sondern auf die Menschheit.33 Es ist eine, die das Beste in der Welt will, auch wenn das heißt, gegen die egoistischen Interessen des Vaterlandes zu handeln. Das ist auch der Grund, weshalb Markus Vilaszek argumentiert: „Kants Begriff des Weltbürgertums geht über den rechtlichen Kosmopolitismus (Weltbürgerrecht) und politischen Kosmopolitismus (Weltfriedensordnung) noch hinaus. Bereits die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785 hatte den einzelnen Menschen als Teil der Gemeinschaft aller vernünftigen Wesen, als Bürger im ‚Reich der Zwecke‘ beschrieben. In späteren Werken entwickelte Kant daraus den Gedanken eines moralischen Kosmopolitismus, dem zufolge man sich als Teil einer alle Menschen einschließenden Weltgemeinschaft betrachten solle. Eine solche ‚weltbürgerliche Gesinnung‘ sei ein notwendiges Korrektiv der menschlichen Neigung zu moralischem Egoismus und religiöser Intoleranz. Sie betrachtet alle Menschen als gleichberechtigte Mitglieder einer globalen Gemeinschaft …“34
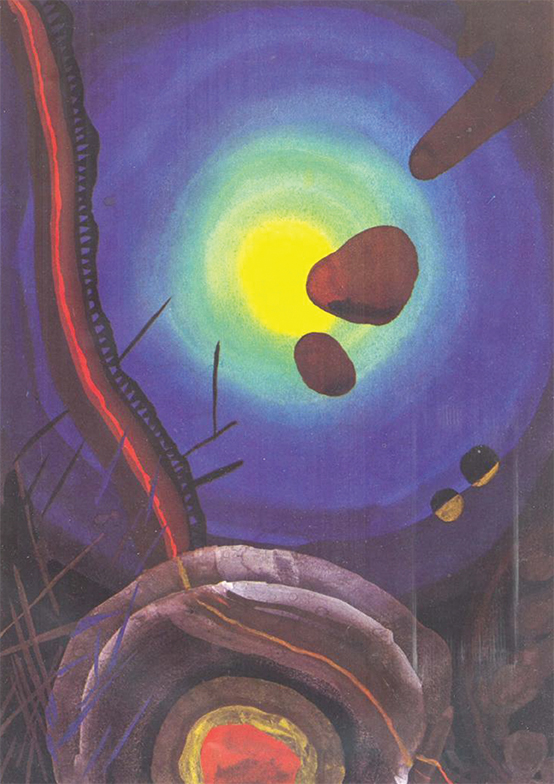
Siebte These: Die kantische Aufklärung ist nicht antireligiös, sondern gegen jene Religion, die sich als Vormundschaft verwirklicht. Darüber werden sich die Kommentatoren Kants freilich nicht immer einig sein.
Siebte These: Die kantische Aufklärung ist nicht antireligiös, sondern gegen jene Religion, die sich als Vormundschaft verwirklicht. Darüber werden sich die Kommentatoren Kants freilich nicht immer einig sein. Heinrich Heine wird Kants Kritik der reinen Vernunft und deren Bedeutung mit der Französischen Revolution vergleichen. Er schreibt dazu: „Auf beiden Seiten des Rheins sehen wir denselben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition wird alle Ehrfurcht aufgekündigt; wie hier in Frankreich jedes Recht, so muss dort in Deutschland jeder Gedanke sich justifizieren, und wie hier das Königtum, der Schlussstein der alten sozialen Ordnung, so stürzt dort der Deismus, der Schlussstein des geistigen alten Regimes“.35 Außerdem wendet sich Heine an die Franzosen und sagt, dass sie es mit der Verherrlichung ihrer Revolution und ihres Anführers Robespierre übertreiben, weil er nur einen König getötet hat, während Kant, seiner Meinung nach, die gesamte alte Ordnung töten würde und mehr Ehrung als Robespierre verdiene. Er hat „an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit [übertroffen]“.36 Doch selbst wenn diese Ansicht bei einigen Kommentatoren auch heute noch bestehen würde,37 würde die Mehrheit von ihnen eine andere Richtung einschlagen.38 Dies wird von John Hare bestätigt, der Lesarten, die die kantische Ethik als absolut vom Theismus geschieden betrachten, als reduktiv bezeichnet, weil sie nicht alle Texte Kants zu diesem Thema gelesen haben – einschließlich desjenigen, in dem der Königsberger Philosoph behauptet, dass der Zustand des skeptischen Atheisten ein instabiler ist. Er verfällt, ihm zufolge, immer wieder der Hoffnung in Zweifel und Misstrauen.39 Hare fügt hinzu: „Kant wollte Gott nicht vom Thron stoßen. Sein System setzt eine göttliche Person voraus, die sowohl einen Willen als auch einen Verstand hat, die uns Befehle geben und eingreifen kann, um in uns die Revolution unseres Willens zu vollziehen, und die die Zwecke aller vernünftigen Wesen koordinieren kann, um ein Reich der Zwecke zu bilden. Deshalb sagt Kant im gesamten Werk immer wieder, dass wir unsere Pflichten als Gebote Gottes erkennen müssen.“40
Es ist äußerst wichtig, zu betonen, dass die Ethik Kants nicht antireligiös ist, insbesondere in einem Kontext wie dem arabischen. Wir haben es mit einer Kultur zu tun, die in einer religiösen Sprache lebt, denkt, sich verständigt und sich ausdrückt, und wir können ihr nicht außerhalb dieser Sprache begegnen. Verschiedene Strömungen – liberale, marxistische, säkulare etc. – haben dies versucht, aber es ist ihnen nicht gelungen, einen Einfluss auf das Los der Gesellschaft zu nehmen. Diese Strömungen blieben weit entfernt, losgelöst vom Schicksal der Völker der Region und in vielen Fällen stellten sie sich an die Seite der herrschenden politischen Regime. Die Politik der reinen Verwestlichung, die ich als unsolidarisch bezeichne, beraubt uns nicht nur der „Hoffnung auf das höchste Gut“, sondern auch jeder Beziehung zur Realität und zu anderen Menschen und Kulturen. Sie übersetzt die Moderne eher in eine Logik der Vormundschaft als der Befreiung. Kant selbst würde anmerken, dass seine Zeitgenossen über das Christentum zum Sittengesetz gefunden haben und, dass der Atheismus eine Gefahr für die gesamte Menschheit darstellt.41
Ernst Cassirer bietet in seinem Klassiker Die Philosophie der Aufklärung ein Korrektiv zur jakobinischen Geschichte der Aufklärung, wie wir sie im arabischen Kontext durch die französische Literatur kennengelernt haben. Er argumentiert, dass es sich um eine eindimensionale Lesart handelt, die die Aufklärung als eine Ablehnung der Religion versteht. Dies mag für die französische Aufklärung zutreffen, nicht jedoch für die deutsche und englische Aufklärung.42 Gleichzeitig betont er Folgendes: „Die stärksten gedanklichen Impulse der Aufklärung und ihre eigentliche geistige Kraft sind nicht in ihrer Abkehr vom Glauben begründet, sondern in dem neuen Ideal der Gläubigkeit, das sie aufstellt, und in der neuen Form der Religion, die sie in sich verkörpert.“43 In diesem Zusammenhang wird der Glaube nicht als Feind des Wissens dargestellt, sondern als Feind jenes religiösen Wissens, das das Wissen und damit den Glauben verfälscht. In Cassirers Worten: „Der eigentliche radikale Gegensatz zum Glauben ist nicht der Unglaube, sondern der Aberglaube.“44 Und er fügt hinzu: „Die entscheidende Wandlung vollzieht sich dadurch, dass an Stelle des religiösen Pathos, das die vorangehenden Jahrhunderte, die Jahrhunderte der Glaubenskämpfe bewegt und vorwärtsgetrieben hatte, ein reines religiöses Ethos tritt.“45 Mit Ethos meint Cassirer hier die Freiheit des Menschen, das Religiöse zu gestalten, das als und in Freiheit zu leben und nicht als eine „fremde Kraft“, die den Menschen überwältigt und über sein schalten und walten ganz und gar entscheidet.46
Achte These: Die von Kant vertretene Vernunftreligion hat die innere Vervollkommnung des Menschen zum Ziel.
Achte These: Die von Kant vertretene Vernunftreligion hat die innere Vervollkommnung des Menschen zum Ziel. Deshalb wird die Vernunftreligion in ständigem Konflikt mit dem kirchlichen Glauben stehen, der durch seine Unterdrückung der Vernunft die Vernunftreligion in den Konflikt zwingt. Und deshalb argumentiert Kant, dass die Geschichte des Glaubens nichts anderes ist als die Geschichte des ständigen Kampfes zwischen der Religion des Gehorsams und der Religion der Moral. Für Saner (hier, bzw. zu Saner fehlt der Literaturhinweis) bekämpft die Dienstreligion in der Vernunftreligion die Vernunft selbst, weil sie die Zerstörung des freien Glaubens fordert und die Vernunftreligion die Befreiung des Glaubens von der Macht des Zwangs und des Ausschlusses verlangt. Aber wir sollten, wie Saner erklärt, nicht denken, dass Kant die auf Offenbarung beruhende Religion ablehnt – im Gegenteil: Er könnte sie in dem Maße für notwendig halten, in dem sie den Anforderungen der Evolution entspricht und sich der Vernunft annähert.
Saner betont, dass dieser Widerspruch zwischen zwei Formen von Religion – der Religion des Gehorsams einerseits, und der Religion der Vernunft oder der Freiheit andererseits – Ausdruck zweier Arten von Konflikten ist. Einen Unlegitimen, weil er sich nicht auf die Vernunft stützt und nicht auf die Vernunft abzielt, und weil es sich um einen Konflikt handelt, der die Vernichtung des Gegners, der anderen Offenbarung oder der anderen Religion verlangt, wie die Religionskriege in Europa oder die sektiererischen Kriege im arabischen und islamischen Kontext, in denen der Frieden ausschließlich über die Leichen anderer erlangt wird. Es gibt aber auch eine andere Form des Konflikts, die er als legitimen Konflikt bezeichnet – das heißt einen Konflikt, der auf Frieden abzielt, aber in Freiheit. Beide Konflikte fordern Einheit oder Frieden, aber der eine Frieden ist der Sieg der Vernunft und der andere der Sieg der Gewalt. Deshalb lehnt Kant eine Einheit ab, die nicht auf Freiheit beruht, und sucht nach einer Einheit, die Vernunft sowie Freiheit erfordert.47 Heute sprechen wir eher von Religiosität als von Religion. Wir sind uns heute bewusster, dass eine religiöse Reform nicht nur über die ‚Kantische Kaltwasseranstalt‘ laufen muss, sondern dass sie an soziale und politische Bedingungen geknüpft ist und sich nur erreichen lässt, wenn sie mit einer wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Renaissance und der Demokratisierung der politischen Institutionen usw. zusammentrifft. Kants Kritik an der Religion seiner Zeit liefert uns allerdings ein Modell für eine Religionskritik, die nicht wie die französische Aufklärung die radikale Entfernung der Religion aus dem menschlichen Leben oder dem öffentlichen Raum fordert, d. h. die Erlangung des Friedens durch Zwang und Gewalt, was nicht mehr als eine säkularisierte Version der religiösen Gewalt darstellt, sondern deren Umwandlung von innen heraus, wie es die deutsche und angelsächsische Aufklärung forderte. Der Weg zu Moral sowie ethischer Religion führt über Vernunft und Freiheit; und jeder Krieg der Religion gegen die Vernunft ist, wie Kant in der Vorrede zu seinem Buch Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft erklärt, ein verlorener Krieg.
Neunte These: Es gibt nicht den einen Islam. Es gibt Mehrere. Der marokkanische Historiker Abdallah Laroui schreibt Folgendes: ,Der Historizismus macht jeden Dialog über die Zeit hinweg problematisch.‘
Neunte These: Es gibt nicht den einen Islam. Es gibt Mehrere. Der marokkanische Historiker Abdallah Laroui schreibt Folgendes: „Der Historizismus macht jeden Dialog über die Zeit hinweg problematisch.“48 Er warnt damit vor fadenscheinigen Versuchen, die das Prinzip der Historizität missachten und sich auf die Suche nach den Wurzeln der Aufklärung in einer vormodernen Epoche begeben. Was solche Versuche im arabisch-islamischen Kontext in der Tat kennzeichnet, ist, dass sie von einem essentialistischen Verständnis des Islam ausgehen, das den Islam als eine statische, weltenthobene Religion betrachtet, die von der Geschichte losgelöst ist. Solche Versuche reproduzieren die Position des Orientalismus, der – meiner Meinung nach – in seinen jakobinischen Auswüchsen die Pluralität, die den Islam kennzeichnet, nicht erkannt hat. Hat nicht einer der größten deutschen Orientalisten geschrieben, dass der Islam eine Gesetzesreligion ist, dass er in die kleinsten Details des menschlichen Lebens eindringt und nicht zwischen dem Religiösen sowie dem Säkularen unterscheidet, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass er eine „totalitäre“ Religion ist?49 Ist das nicht eine essentialistische Auffassung des Islam, die ihn als eine Religion betrachtet, die über der Geschichte und dem historischen Wandel steht? Können wir einer solchen Religion außerhalb unserer Vorurteile begegnen? Diese Vorurteile werden durch die Behauptungen bestätigt, dass der Islam das Gewissen nicht als unabhängige Autorität anerkenne und dass der Muslim „nicht nach dem Gewissen [handelt], sondern nach dem Willen Gottes“.50 Es heißt, dass der Muslim seine Religion nicht ethisch, sondern als äußere Autorität lebt. Gewiss verwirklicht sich der moderne Islam, jener der Moderne, als eine arme und kulturfeindliche Religion, aber der Islam, den man nur im Plural verstehen kann, wie Mohammed Arkoun uns das lehrt, ist nicht auf diese Islamität zu reduzieren. Dies zu tun, grenzt an einen epistemologischen Populismus, der heute das Bild des Islam und der Muslimen in westlichen Medien zum größten Teil, ausmacht. Gewiss ist allein der protestantische Weg noch offen. Damit meine ich die Übersetzung religiöser Intuitionen in die Sprache der zeitgenössischen Ethik oder das, was Kant die Vernunftreligion nannte, aber letztlich dürfen wir nicht über einen Islam im Absoluten sprechen. Dies zu machen, gleicht, zu sagen, dass der Islam und damit auch die Muslime sich nicht aufklären lassen oder unfähig sind Bürger einer Demokratie zu sein, wie etwa Peter Sloterdijk in unverschämter Weise behauptet.51
Meine Kritik gilt hier dem Islam, wie er sich in der Moderne ausdrückt. Zweifellos ist dieser Islam in seinen Erscheinungsformen Ausdruck der enormen Widersprüche dieser Moderne. Bourdieu stellt eine Verbindung her zwischen dem „Irrationalismus der Verzweiflung“, also dem Terrorismus, und den „Mächten, die sich auf die Vernunft berufen“.52 Der Orientalismus bleibt aber unfähig im Ausgang von der Gesellschaft und der Geschichte zu denken. Die islamische Kultur ist in dem weltenthobenen Weltbild, das das kolonialistische Abenteuer begleitet hat, die Mühe der Geschichte nicht wert.
Man kann jedoch nicht leugnen, dass die Christen heute ihre Beziehung zu Gott persönlich oder als religio und nicht als dominatio leben, während die heutigen Muslime zu laut glauben und damit ihre Nachbarn stören. Dieser ‚laute‘ Glaube repräsentiert den Islam jedoch nicht in seinem Pluralismus und er beschränkt sich nicht auf den zeitgenössischen Islam. Vielmehr bringt er das Scheitern der säkularen Befreiungsideologien zum Ausdruck. Das Scheitern des säkularen Modells und die Entstehung neuer Kräfte auf der Grundlage der Religion, die der Nationalstaat einer fernen Vergangenheit zuzuordnen glaubte, beschränkt sich nicht nur auf den islamischen Kontext. Michael Walzer hat es ebenfalls in drei historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, die miteinander nichts Gemeinsames haben, festgestellt: Algerien, Indien und Israel.53 Allerdings sind wir es im westlichen Kontext gewohnt, lediglich den Islam zu kritisieren.
Zehnte These: Moral ohne Religion ist leiblos, und Religion ohne Moral ist seelenlos. Trotz aller Kritik, die die kantische Ethik in der modernen Philosophie, beginnend mit Hegel, geerntet hat und die in dieser Ethik einen leeren Formalismus gesehen hat, war Kant sich bewusst – wie er es auch in der Metaphysik der Sitten, ausgehend von den Stoikern, geäußert hat -, dass die Tugend ohne Übung nicht gelehrt werden kann.
Zehnte These: Moral ohne Religion ist leiblos, und Religion ohne Moral ist seelenlos. Trotz aller Kritik, die die kantische Ethik in der modernen Philosophie, beginnend mit Hegel, geerntet hat und die in dieser Ethik einen leeren Formalismus gesehen hat, war Kant sich bewusst – wie er es auch in der Metaphysik der Sitten, ausgehend von den Stoikern, geäußert hat -, dass die Tugend ohne Übung nicht gelehrt werden kann. Nur im Leben und in der Verbindung mit dem Leben ist eine wahre Vorstellung der ethischen Pflicht möglich. Aber über Übungsformen, die diese Ethik verwirklichen können, sagt er nichts, wie Rolf Elberfeld bemerkt, der diese Ethik zu Recht als Ethik „von oben“ beschreibt.54 Kants Beitrag bleibt theoretischer Natur. Elberfeld sieht, in seinem interkulturellen Ansatz, im Buddhismus eine Art Zusatz an diese Ethik von Oben, die keine Hände, die nur reine Hände hat, wie sie Peggy Literaturhinweis fehlt beschreibt, weil der Buddhismus ihm zufolge dagegen „versucht (…) ‚von unten‘, ausgehend von der konkreten Situation der leiderzeugenden Verstrickungen des Menschen in seine Gefühle, Triebe, egoistischen Absichten usw., die Abhängigkeitsstrukturen seiner selbst in sich selbst und mit den Anderen durch Achtsamkeitsübungen auf allen Ebenen menschlicher Existenz durchsichtig zu machen“.55 Er fügt hinzu: „Im Buddhismus reicht es nicht, die vernünftige Einsicht im Denken zu erlangen, vielmehr muss sich diese Einsicht auch in alle Ebenen des Gefühls, der Wahrnehmung und des Körpers ausbreiten.“56
Was Elberfeld sagt, bedeutet, dass die kantische Ethik nicht sich selbst genügt, sondern ihre Erfüllung im interkulturellen Abenteuer findet (sehr schön!!), etwa im Dialog mit dem Buddhismus. Aber was wir aus diesem Dialog zwischen Kantianismus und Buddhismus auch schließen können und was Elberfeld nicht gesagt hat, weil seine Argumente ausschließlich mit der Verteidigung der interkulturellen Philosophie sowie der Notwendigkeit der Überwindung des philosophischen Eurozentrismus verbunden sind, ist, dass die kantische Ethik sich erst in ihrer Offenheit gegenüber der Religion verwirklicht. Das hat ein Philosoph des frühen 20. Jahrhunderts, Hermann Cohen, bemerkt. Cohens Beitrag erweist sich in diesem Zusammenhang als von entscheidender Bedeutung. Er basiert nicht nur auf der aufklärerischen Idee, dass Religion auf Moral basieren muss, sondern bestätigt überdies auch die Notwendigkeit der Religion für die Moral, wenn diese Moral in die Realität der Menschen eindringen und in ihr verwirklicht werden soll. „Denn in der Religion geht es nicht nur um das ‚Ich der Menschheit‘, sondern auch und vor allem um die Witwe, die Waise, den Mittellosen, den Fremden, nicht um den Menschen, sondern um diesen Mann, der in besonderen Situationen gefangen ist, welche sich das Leidens beziehen“.57
Dieses Verständnis der Rolle, welche die Religion spielen kann, und ihre Beziehung zur Ethik definiert nicht nur die Ethik, sondern ebenfalls die Religion neu. Religion ist nicht auf reine metaphysische Dogmen zu reduzieren, die von der Realität der Menschen entfremdet sind, sondern ist eine Beziehung zum Anderen und zum sozialen Leid. Mit anderen Worten: Religion ist kein „Opium für das Volk“, sondern ein Aufruf zur Verantwortung. Das Verhältnis zwischen Religion und Moral beruht laut der Vision von Hermann Cohen nicht auf einem Legitimitätskonflikt, sondern es handelt sich eher um ein komplementäres Verhältnis. Die Universalität des Sittengesetzes erhebt es über die Besonderheiten, es „entreißt das Ich des Menschen zuvörderst der Individualität“.58 Sie sieht nur den abstrakten Menschen, aber sie sieht nicht den leidenden Menschen oder den Menschen in seinem Fleisch und Blut, daher rührt ihr Bedürfnis nach Religion, durch die das moralische Ideal in die Realität umgesetzt wird. Cohen zufolge: „Es gibt ein historisches Musterbeispiel für die Notwendigkeit einer Ergänzung der Ethik durch die Religion. Dieses bietet die Stoa in ihrem Verhältnis zum Leiden der Menschen. Sie proklamiert dieses als ein Indifferentes, und schließt es demgemäß aus dem Bereiche des Sittlichen aus. Diese Konsequenz des stoischen Dualismus, der zwischen Spiritualismus und Materialismus in allen Fragen schwankt, ist ein doppelter Fehler. Erstens bildet auch für das Ich das Leiden ein keineswegs indifferentes Moment. Das Selbstbewusstsein darf vielleicht auch seiner sittlichen Forderung wegen nicht Gleichgültigkeit beobachten gegenüber dem physischen Leiden. Zweitens aber darf dem Anderen gegenüber diese Beobachtung nicht gleichgültig bleiben. Und es ergibt sich die Frage, ob nicht gerade durch die Beachtung des Leidens bei dem Anderen dieser Andere aus dem Er sich in das Du verwandelt. Bei bejahender Lösung dieser Frage tritt die Eigenart der Religion in Kraft, unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zur ethischen Methode“.59
Wenn wir uns nun dem Islam zuwenden, werden wir konstatieren, dass der Glaube im Koran mit Dankbarkeit gleichbedeutend ist und dass diese Dankbarkeit einen Ausbruch aus sich selbst, aus dem Ersticken im Selbst, einschließt, weil sie sich als Verantwortung gegenüber anderen verwirklicht. „Wer den Menschen nicht dankt, dankt Gott nicht“, heißt es in einem prophetischen Hadith, und vielleicht finden wir keine besseren Worte als die von Emmanuel Levinas über die Bibel, um diese Logik der Dankbarkeit, die die ethische Botschaft des Korans ausmacht, zu beschreiben, nämlich: „Dass sich die Beziehung zum Göttlichen mit der Beziehung zur Menschheit überschneidet und mit sozialer Gerechtigkeit zusammenfällt, ist der ganze Geist der jüdischen Bibel. Moses und die Propheten interessierten sich nicht für die Unsterblichkeit der Seele, sondern für die Witwe, den Armen, die Waise und den Fremden.“60 Es ist diese immanente Beziehung zu Gott, die wir heute wiederentdecken müssen. Sie bedeutet Verantwortung gegenüber anderen, Wohlwollen, Güte im Kleinen statt des großen Guten der Theologie. Das ist es, was wir heute wiederentdecken müssen und was in den Worten von Levinas eine Religion der Erwachsenen darstellt.
Quellen:
- Michel Foucault, Qu’est-ce que les lumières ? in : Dits et écrits II, Paris : Gallimard 2017, S. 1499.
- Otfried Höffe, Eine republikanische Vernunft. Zur Kritik des Solipsismus-Vorwurfs, in: Kant in der Diskussion der Moderne, (Hg.) Gerhard Schönrich und Yasuschi Kato, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S. 398.
- Reinhard Brandt, Die Bestimmung des Menschen als Zentrum der kritischen Philosophie, in: Kant in der Gegenwart, (Hg.) Jürgen Stolzenberg, De Gruyter 2007, S. 18.
- Ebd. S. 47.
- Ebd. S. 1506.
- Susan Neiman, Why Grow up? Subversive Thoughts for an Infantile Age, London: Penguin Books, 2016, S. 51.
- Ebd. S. 175
- Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes. Traditionalisme ou historicisme ? Casablanca : Centre culturel du livre 2021, S. 8.
- Ebd., S. 188–89.
- Abdellah Hammoudi, Master and Disciple. The cultural foundations of Moroccan authoritarianism, Chicago & London: Chicago Press 1997, S. 1.
- Ebd., S. 5.
- Hisham Sharabi, Neopatriarchy. A Theory of Distorted Change in Arab Society, New York- Oxford: Oxford University Press, 1988, S. 28-29.
- Immanuel Kant, Über die Erziehung, München: dtv 1997, S. 17.
- Immanuel Kant, Über die Erziehung, München: dtv 1997, S. 16-17.
- Daniela Tafani. Das Recht auf unsinnige Entscheidungen: Kant gegen die neuen Paternalismen, in: Zeitschrift für Rechtsphilosophie, 1, 2017, S. 63.
- Ebd., S. 66.
- Vgl. Gert Biesta, Foundations of democratic education: Kant, Dewey, and Arendt, in: Democratic Practices as Learning Opportunities, (eds.) Ruud van der Veen, Danny Wildemeersch, Janet Youngblood, and Victoria Marsick, Brill 2007, S. 7-17
- Ebd. S. 144.
- Habermas, J. Die Nachholende Revolution, Kleine politische Schriften VII. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, S. 219.
- Otfried Höffe, Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. München: C.H. Beck 2012, S. 410.
- Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1998, S. 785.
- Ebd., S. 789.
- Ebd., S. 789.
- Ebd., S. 795.
- Hans Saner, Kants Weg vom Krieg zum Frieden, I. München: Piper , S. 258.
- Ebd., S. 264
- Hans Michael Baumgartner, Der friedenstiftende Funktion der Vernunft. Eine Skizze, in: Kant in der Diskussion der Moderne, (Hg.) Gerhard Schönrich und Yasuschi Kato, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S. 54.
- Otfried Höffe, Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. München: C.H. Beck 2012, S. 16.
- Ebd., S. 19.
- In jüngerer Zeit verbindet Christoph Menke das Modell und Projekt der westlichen Kultur mit dem griechischen Begriff der Freiheit als Befreiung. (Christoph Menke, Theorie der Befreiung, 2022, S. 30–31). Damit reduziert Menke die Idee der Befreiung auf die griechische und europäische Zivilisation und bleibt Hegel, dem Philosophen des germanischen Zentrismus, treu, der die meisten menschlichen Geschichten aus seiner Weltgeschichte ausgeschlossen hat. Was der westliche Philosoph über die Befreiung sagt, sagt er auch über die Revolution. Wenn der westliche Philosoph den Architext der Befreiung in der antiken griechischen Kultur findet oder den des Sinnes in der griechischen Tragödie und später im westlichen Christentum (Karen Gloy, Zwischen Glück und Tragik, 2013), wird er den Architext der Revolution im Exodus der Juden aus Ägypten in das Land Kanaan finden. (Gunnar Hindrichs, Philosophie der Revolution 2017), als ob wir nicht ähnliche Revolutionen in anderen Zivilisationen kennen würden und als ob Gott, um Hermann Cohen zu paraphrasieren: „zwei Menschheiten geschaffen hat, nicht eine“! Die exklusive Verknüpfung der großen Konzepte der Moderne mit der westlichen Geschichte und Kultur impliziert eine epistemologische Gewalt, die wiederum jede andere Form der Gewalt gegen die anderen rechtfertigen wird.
- Otfried Höffe, 2012, S. 48..
- Kant, Über die Erziehung, S. 17.
- Otfried Höffe, Der Weltbürger aus Königsberg. Immanuel Kant heute. Person und Werk, 2023, S. 322.
- Marcus Willaschek, Kant. Die Revolution des Denkens. München: C.H. Beck 2023, S. 182.
- Heinrich Heine, Über die Philosophie Immanuel Kants, in: Freidenker, Band 41, Heft 7, 1958, S. 212
- Ebd., Seiten 215–216.
- Manfred Kühn, Kant, A Biography, Cambridge: Cambridge University Press 2002.
- Philip J. Rossi, Michel Wreen (eds.), Kant’s Philosophy of religion reconsidered, Bloomington: Indiana University Press 1991.
- John Hare, Kant on the Rational Instability of Atheism, In Andrew Dole & Andrew Chignell (eds.), God and the Ethics of Belief: New Essays in Philosophy of Religion (Festschrift for Nicholas Wolterstorff). New York: Cambridge University Press (2005), S. 202
- Ebd., S. 203.
- Ebd., S. 209
- Ernst Cassirer, Philosophie der Aufklärung, S. 178.
- Ebd., S. 180.
- Ebd., S. 215.
- Ebd., S. 219.
- Ebd., S. 219.
- Ebd., S. 300.
- Abdallah Laroui, Islam et Modernité, Paris : La découverte 1987, S. 127.
- Hans Küng, Josef Van Ess, Christentum und Weltreligionen. Islam, Gütersloher Verlagshaus, 1991, S. 67
- Ebd., S. 76.
- Peter Sloterdijk, Im Schatten des Sinai: Fußnote über Ursprünge und Wandlungen totaler Mitgliedschaft (Berlin: Suhrkamp, 2013), S. 43.
- Pierre Bourdieu, “Les abus de pouvoir qui s’arment ou s’autorisent de la raison”, in: Pierre Bourdieu, Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale (Paris: Raisons d’agir, 1998), S. 25-26
- Michael Walser, The Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions. New Haven: Yale University Press, 2015.
- Rolf Elberfeld, Kants Tugendlehre und buddhistische Übung. Auf dem Weg zu einer kulturoffenen und kritischen Kultivierungspraxis, in: Dimensionen der Selbstkultivierung. Beiträge des Forums für Asiatische Philosophie, Marcus Schmücker, Fabias Heubel (Hg.), Freiburg: Alber 2013, S. 40.
- Ebd., S. 47.
- Rolf Elberfeld, Kants Tugendlehre und buddhistische Übung. Auf dem Weg zu einer kulturoffenen und kritischen Kultivierungspraxis, in: Dimensionen der Selbstkultivierung. Beiträge des Forums fuer Asiatische Philosophie, Marcus Schmücker, Fabias Heubel (Hg.), Freiburg: Alber 2013, S. 40.
- Zitat offenbar übersetzt. bitte überprüfen, bzw. hier unten das Original mitzitieren.Sophie Nordmann, De l’éthique à la religion de la raison : Hermann Cohen lecteur de Kant, in : Haskala et Aufklärung. Philosophes juifs des Lumières Allemandes, Revue Germanique internationale, 9-2009, S. 192
- Hermann Cohen, Die Religion der Vernunft aus dem Quellen des Judentums, Leipzig: Gustav Fock 1919, S. 15.
- Ebd., S. 19.
- Emmanuel Levinas, “Une religion d’adultes”, in Difficile liberté : essais sur le judaïsme, Paris : libre de Poche, 1984, S. 36.
Rachid Boutayeb
ist Professor für Philosophie am Doha Institute for Graduate Studies. Er studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg und promovierte mit einer Arbeit über Emmanuel Levinas an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zuletzt erschien in deutscher Sprache “Tristesse oblige. Eine kleine Philosophie der Nachbarschaft”, Alibri 2022.